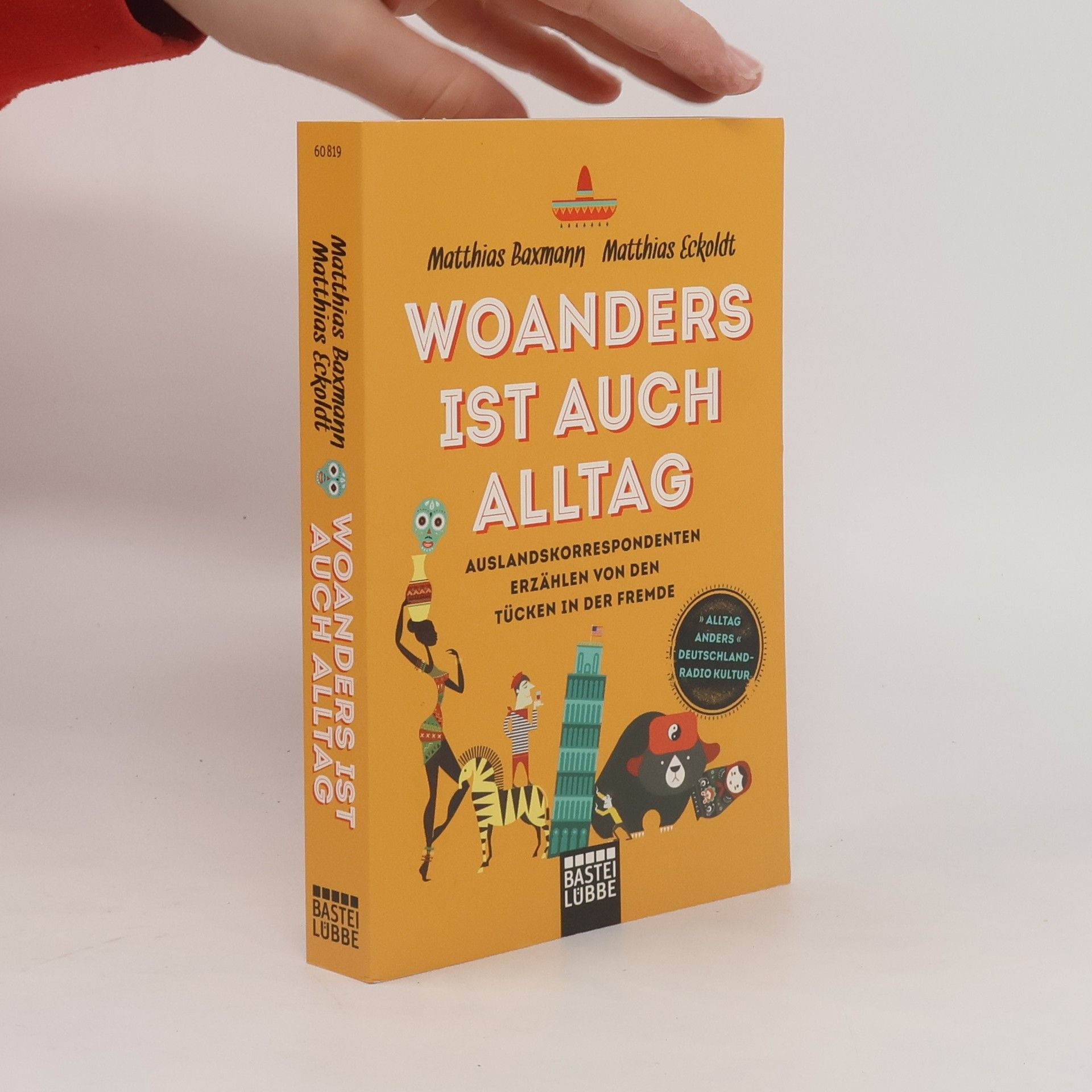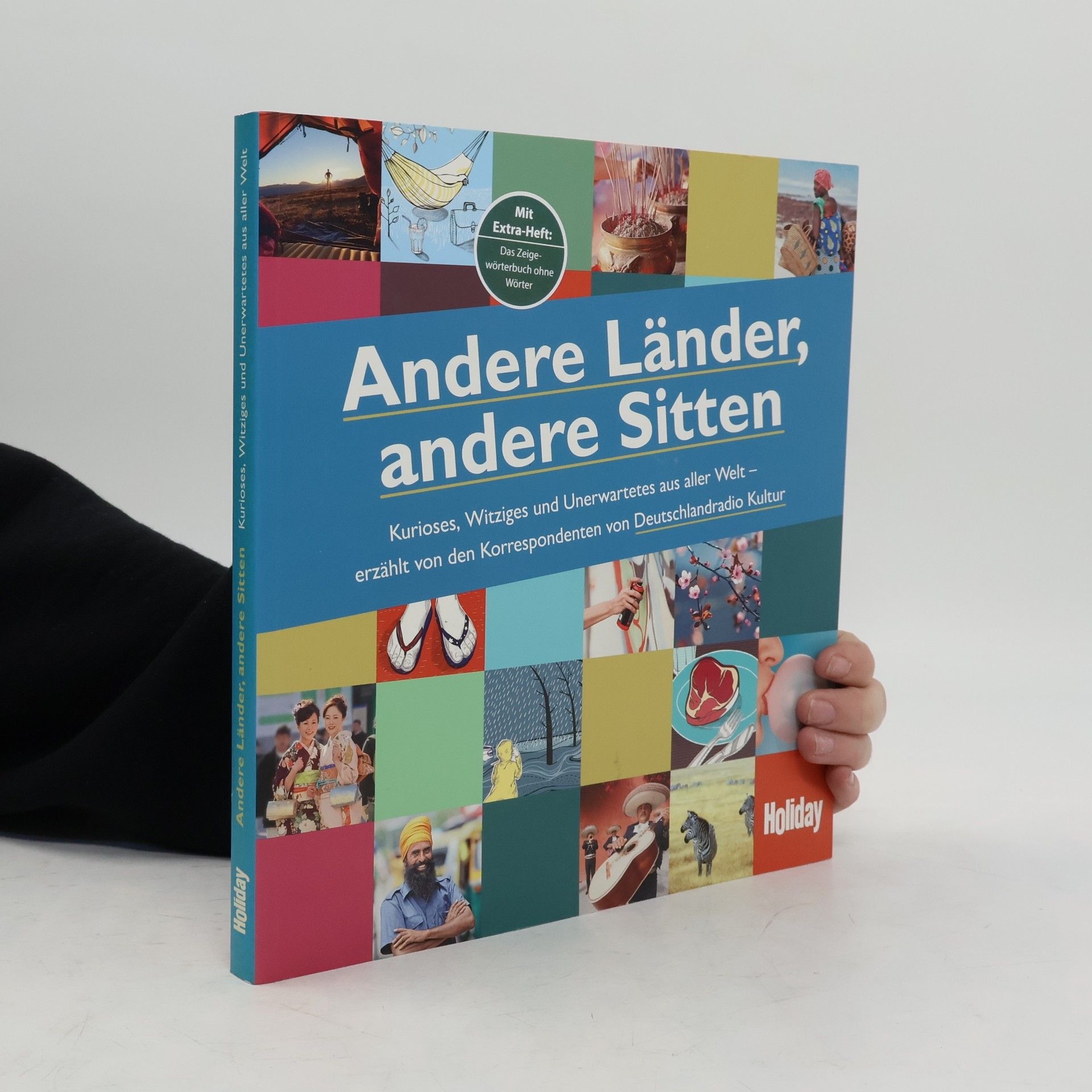Wasserwege
Schleusen, Wehre und Kanäle in Brandenburg
„Es geht mit den Geschichten wie mit Strömen, die erst da ihre Wichtigkeit erlangen, wo sie anfangen, schiffbar zu werden.“ Friedrich der Große Das preußische Kernland zwischen Elbe und Oder verfügte am Anfang des 19. Jahrhunderts nach Frankreich und England über das größte zusammenhängende Wasserstraßennetz in Europa. An der Schwelle zum Industriezeitalter war es etwa 800 km lang und zeichnete sich durch eindrucksvolle wasserbauliche Anlagen aus. Es öffnete vor allem Berlin als bedeutendem Gewerbe- und Handelszentrum in der Mitte Europas das Tor zur Welt. Die preußischen Herrscher trieben seit der frühen Neuzeit den Ausbau der brandenburgischen Gewässer im Dienste der Landesentwicklung voran und bewiesen damit eine weitsichtige Verkehrsinfrastrukturpolitik. Die schiffbaren Flüsse und Kanäle im Land Brandenburg mit ihren technischen Einrichtungen sind eindrucksvolle Sachzeugnisse einer 500-jährigen Kulturlandschaftsentwicklung im Herzen Europas, der in diesem Buch nachgespürt wird.