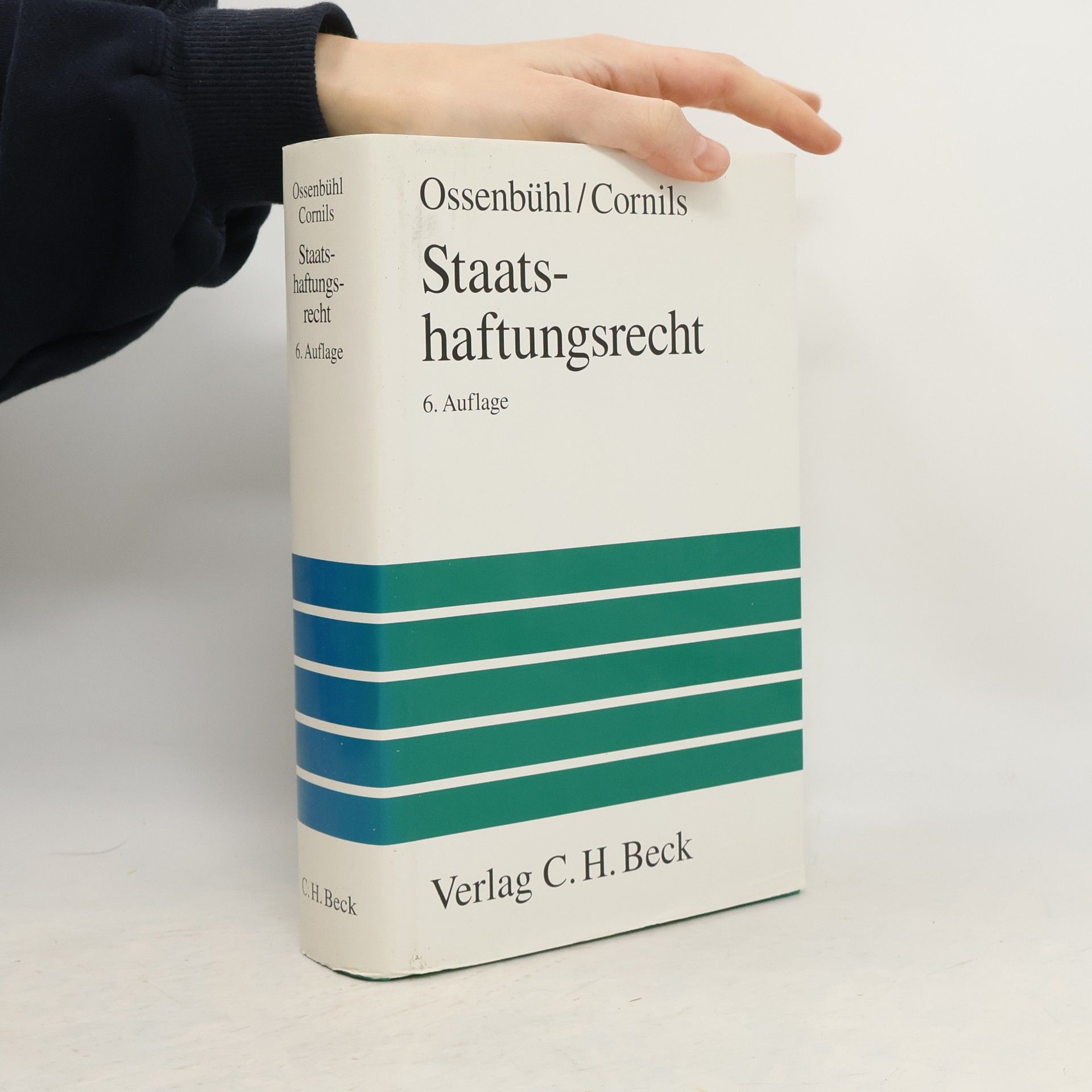Fälle zum Medienrecht
- 250 stránok
- 9 hodin čítania
Das Buch bietet eine umfassende Sammlung von 13 Fällen im Medienrecht, die verschiedene relevante Rechtsgebiete miteinander verknüpfen. Mit ausführlichen Lösungen und praxisnahen Sachverhalten, die häufig bereits juristisch behandelt wurden, eignet es sich ideal zur Vorbereitung auf Abschlussklausuren und mündliche Prüfungen im Schwerpunktfach Medienrecht. Der Autor bringt seine Erfahrungen aus der Medienwirtschaft ein, was die Relevanz und Anwendbarkeit der Fälle unterstreicht. Die Themen umfassen unter anderem Persönlichkeitsrecht, Presserecht und Urheberrecht.