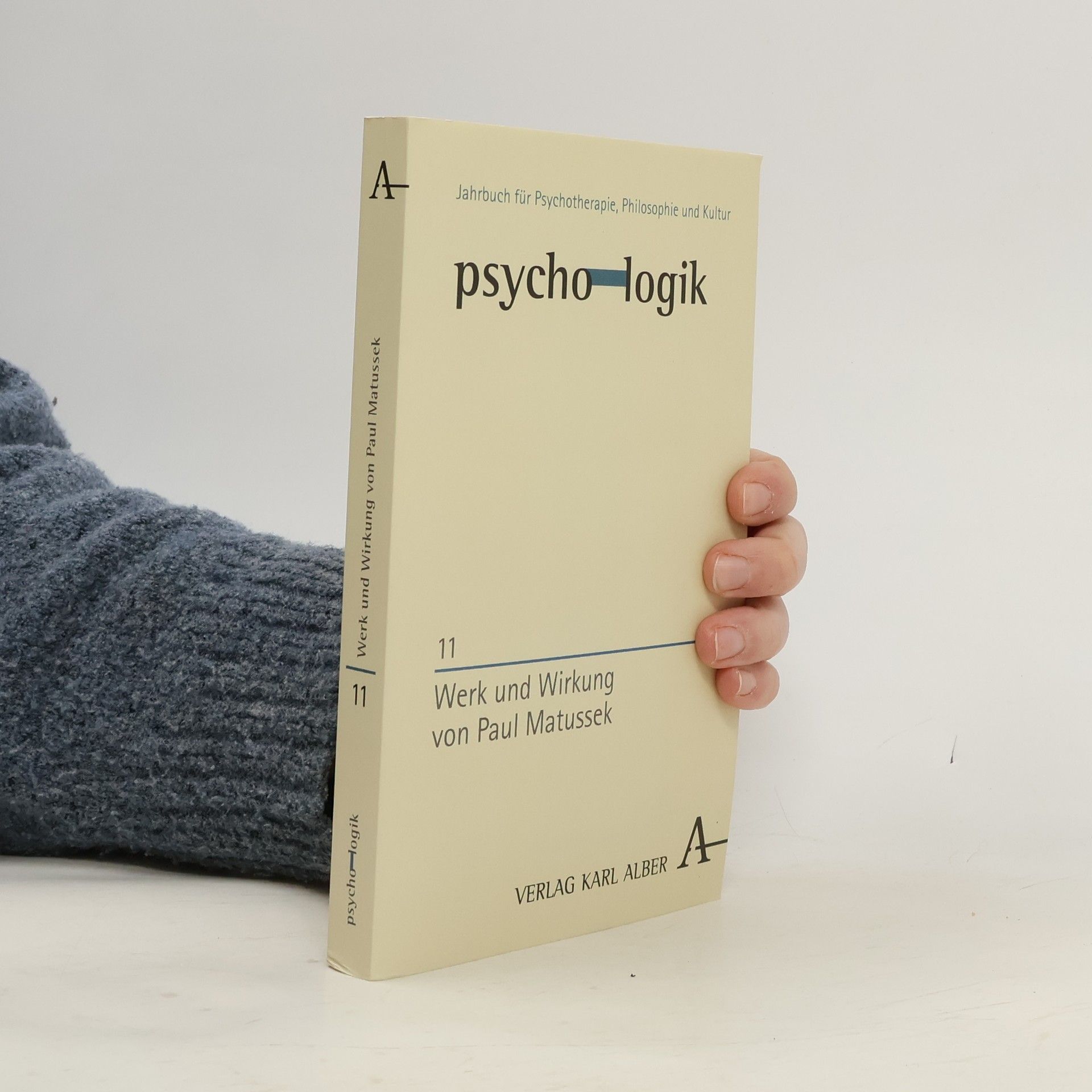Erzählend philosophieren - ein Lehr- und Lesebuch
- 400 stránok
- 14 hodin čítania
Der Band versammelt literarische Texte verschiedenster Art, die philosophische Probleme exponieren und von Philosophen und Literaturwissenschaftlern eingeleitet werden. Als philosophisch-literarisches Lesebuch fuhrt er uber die Auseinandersetzung mit literarischen Texten an philosophische Probleme und das Philosophieren heran. Uber den erzahlenden Zugang zum Philosophieren bietet das Buch nicht zuletzt Anregungen fur Studierende und Lehrende in Philosophie, Ethik, Deutsch und Germanistik, um literarische Texte in einer philosophischen Perspektive zu thematisieren. Mit Texten von James Joyce, Franz Kafka, Alice Munro, Robert Musil, Friedrich Nietzsche, Patrick Roth, Stanislaw Lem, Adalbert Stifter, Martin Walser u.a.