Aspekte sächsischer Landtagsgeschichte
Varianten der Moderne 1868 bis 1952

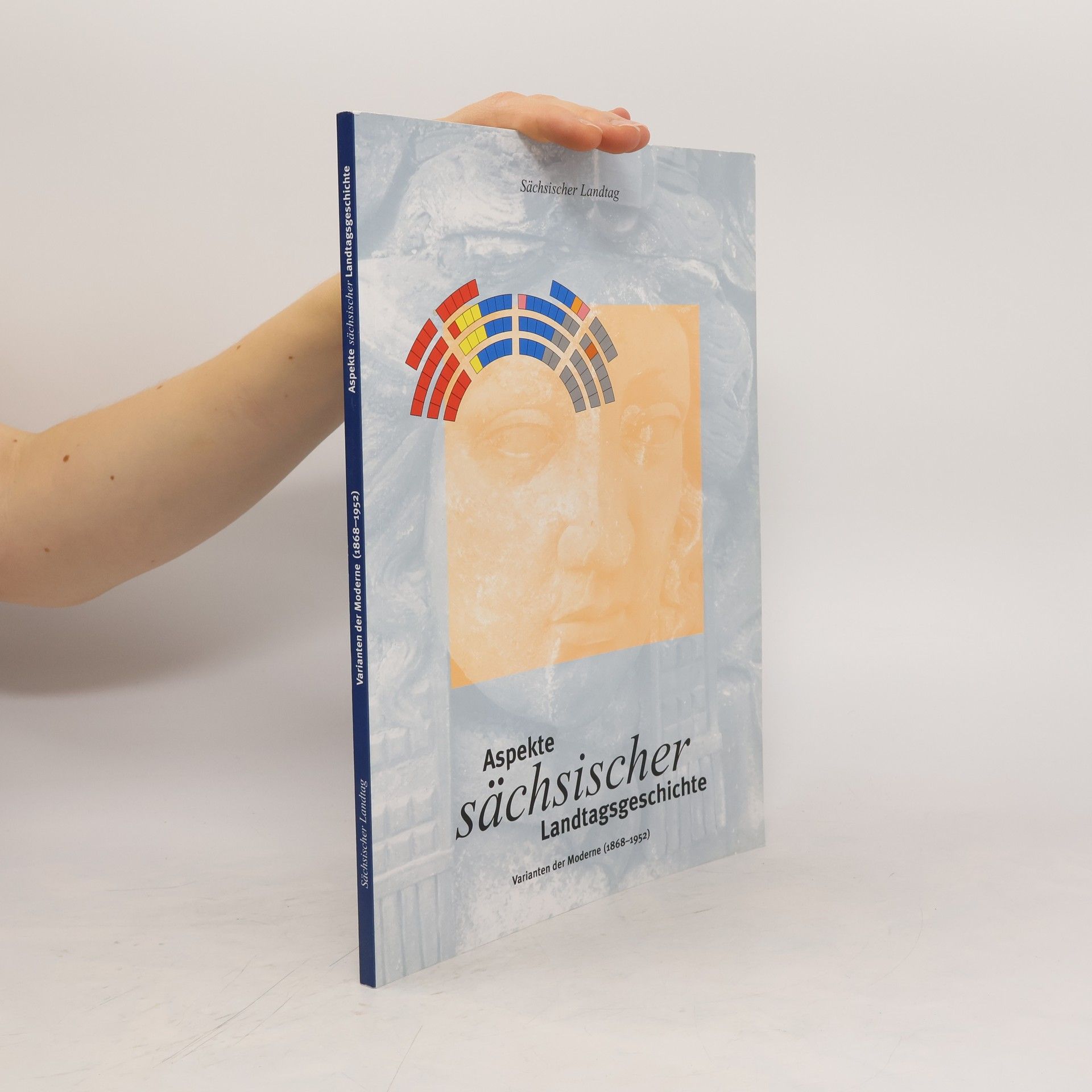
Varianten der Moderne 1868 bis 1952
Kommentierte Quellen zur Geschichte der sächsischen Landtage vom Mittelalter bis in die Gegenwart
Silke Marburg und Edith Schriefl schlagen zu Beginn des Bandes mit ihrem Text "Okonomie von Offenheiten" ein begrifflich-methodisches Instrumentarium vor, um die Geschichte politischer Versammlungen zu diskutieren. Dieser Ansatz ist insbesondere geeignet, sowohl interdisziplinare als auch epocheubergreifende Vergleiche zu fordern. Der zweite Teil des Bandes stellt beispielhafte Quellen zur Geschichte der sachsischen Landtage vom Mittelalter bis in die Zeitgeschichte vor. Die Autoren erlautern Kontext und Quellenwert von Urkunden und Akten, Fotografien und Tagebuchaufzeichnungen, aber ebenso eines Stenogramms, einer Imprese und eines Zeitzeugeninterviews. Gleichzeitig veranschaulichen sie, wie sich Grundbegriffe der "Okonomie der Offenheiten" auf Quellen anwenden lassen.