Lucie Adelsberger
Doctor - Scientist - Chronicler of Auschwitz
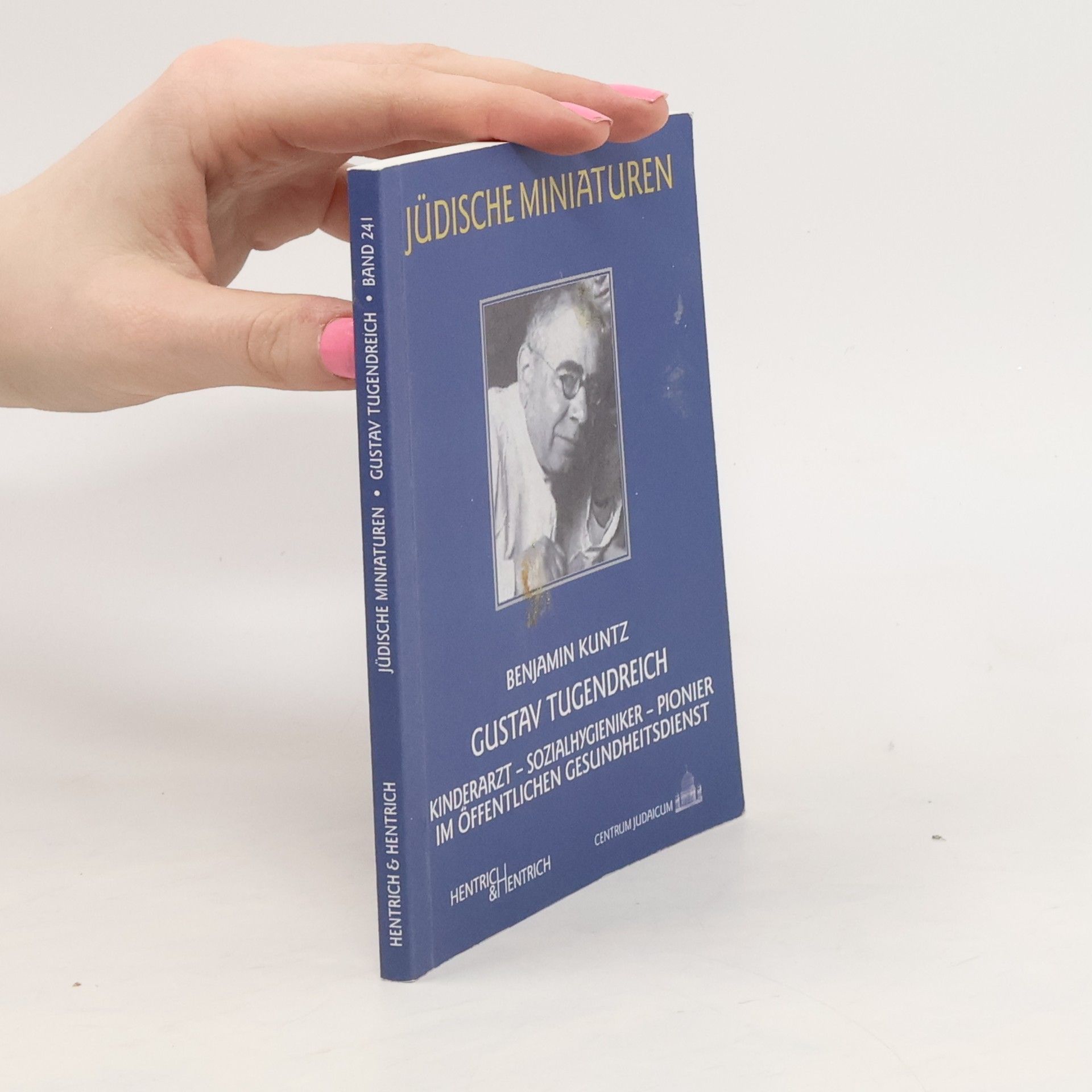





Doctor - Scientist - Chronicler of Auschwitz
“Light instead of cod liver oil” Ultraviolet irradiation against rickets
Internist - Nervenarzt - Pionier der Neuropädiatrie
Georg Peritz (1870-1935) zählt zu den vergessenen Wegbereitern der Neuropädiatrie in Deutschland. Als Internist und Neurologe trug er mit seinem 1912 erstmals erschienenen Buch „Die Nervenkrankheiten des Kindesalters" zur Entstehung eines neuen Fachgebiets an der Schnittstelle von Nerven- und Kinderheilkunde bei. In Berlin arbeitete er mit namhaften Ärzten wie Hermann Oppenheim, Hugo Neumann, Friedrich Kraus, Karl Bonhoeffer, Theodor Brugsch und Rahel Hirsch zusammen. Er war mindestens 17 Jahre an der II. Medizinischen Klinik der Charité tätig und betreute in anderen Krankenhäusern konsiliarisch mehrere Spezialambulanzen. Im Ersten Weltkrieg wurde er ärztlicher Leiter der Schule für Gehirnverletzte und 1919 Titularprofessor der Medizinischen Fakultät. Bis 1933 veröffentlichte er zahlreiche weitere Publikationen, überwiegend zu endokrinologischen und neurologischen Themen
Bakteriologe – Immunologe – Mitbegründer der Chemotherapie
Julius Morgenroth (1871–1924) hat sich als Bakteriologe, Immunologe und Mitbegründer der antibakteriellen Chemotherapie große Verdienste erworben. Nach dem Medizinstudium arbeitete er als Assistent bei Paul Ehrlich – seit 1897 am kurz zuvor in Berlin-Steglitz gegründeten Institut für Serumforschung und Serumprüfung, seit 1899 am Institut für experimentelle Therapie in Frankfurt am Main. Von 1905 bis 1919 war Morgenroth in der bakteriologischen Abteilung des Pathologischen Instituts der Charité tätig, bevor er die Leitung der neu eingerichteten Abteilung für Chemotherapie am Robert Koch-Institut übernahm. Morgenroth forschte auf dem Gebiet der von ihm mitentwickelten Immunitätslehre und trug wesentlich dazu bei, den Wirkmechanismus der Antitoxine zu entschlüsseln. Bahnbrechend war der von ihm und seinen Mitarbeitenden erbrachte Nachweis, dass Bakterieninfektionen durch Chemotherapie behandelt werden können. Lange bevor es Antibiotika gab, entwickelte Morgenroth Medikamente zur Therapie von Lungenentzündungen und Wundinfektionen. Wiederholt für den Nobelpreis vorgeschlagen, verhinderte auch sein früher Tod mit 53 Jahren, dass ihm diese Auszeichnung zuteil wurde.
Die Scherenschnitte der Rose Hölscher in 39 Biographien
Die Universität Frankfurt am Main im Jahr 1920: Die Medizinstudentin Rose Hölscher (1897–1965) ist eine aufmerksame Beobachterin. Mit der Schere beginnt sie im Kolleg, ihre Dozenten zu porträtieren, zunächst – wie sie schreibt – „ohne besondere Absicht“. Nach und nach fertigt sie 39 Scherenschnitte von Mitgliedern der Medizinischen Fakultät an. Als Hölscher nach ihrem Studium 1921 Frankfurt verlässt, übergibt sie ihren Lehrern und Kommilitonen ein in kleiner Auflage gedrucktes Büchlein mit den gesammelten Porträts, „als Erinnerung für spätere Zeiten“. Ihr Werk nennt sie „Frankfurter Charakterköpfe“. 100 Jahre später begeben sich der Medizinhistoriker Benjamin Kuntz, der Arzt Harro Jenss und die Frankfurter Stadthistorikerin Sabine Hock auf eine spannende Spurensuche. Sie wollen herausfinden: Wer war Rose Hölscher? Wie verlief ihr weiterer Lebensweg? Welche Biographien verbergen sich hinter den von ihr geschaffenen Silhouetten? Die Recherchen ergeben, dass unter nationalsozialistischer Herrschaft Rose Hölscher, die mit einem jüdischen Arzt verheiratet war, und etwa die Hälfte ihrer Medizinlehrer aus „rassischen“ oder politischen Gründen systematisch ausgegrenzt und verfolgt wurden. Die wiederentdeckten und neu herausgegebenen „Frankfurter Charakterköpfe“ der Rose Hölscher sind ein einzigartiges Zeugnis Frankfurter und deutscher Medizingeschichte.
Kinderarzt – Sozialhygieniker – Pionier im Öffentlichen Gesundheitsdienst
Gustav Tugendreich (1876–1948) war ein im Öffentlichen Gesundheitsdienst von Berlin tätiger Kinderarzt und Sozialhygieniker. Der langjährige Leiter einer Säuglingsfürsorgestelle engagierte sich besonders für die Stillförderung und den Kleinkinderschutz. Zu seinen herausragenden Werken zählen das Handbuch „Die Mutter- und Säuglingsfürsorge“ sowie der gemeinsam mit Max Mosse herausgegebene Sammelband „Krankheit und soziale Lage“. Als sich die Situation seiner Familie nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten zunehmend verschlechterte, ging Tugendreich 1937 zunächst nach London, bevor er mithilfe der amerikanischen Quäker in die USA emigrierte. Seine Frau und seine beiden Kinder konnten erst wenige Monate vor Kriegsbeginn nachfolgen. Gustav Tugendreich starb am 21. Januar 1948 in Los Angeles – ohne je nach Deutschland zurückgekehrt zu sein.
Im Gedenken an die zwölf jüdischen Mitarbeitenden, die 1933 das Robert Koch-Institut verlassen mussten