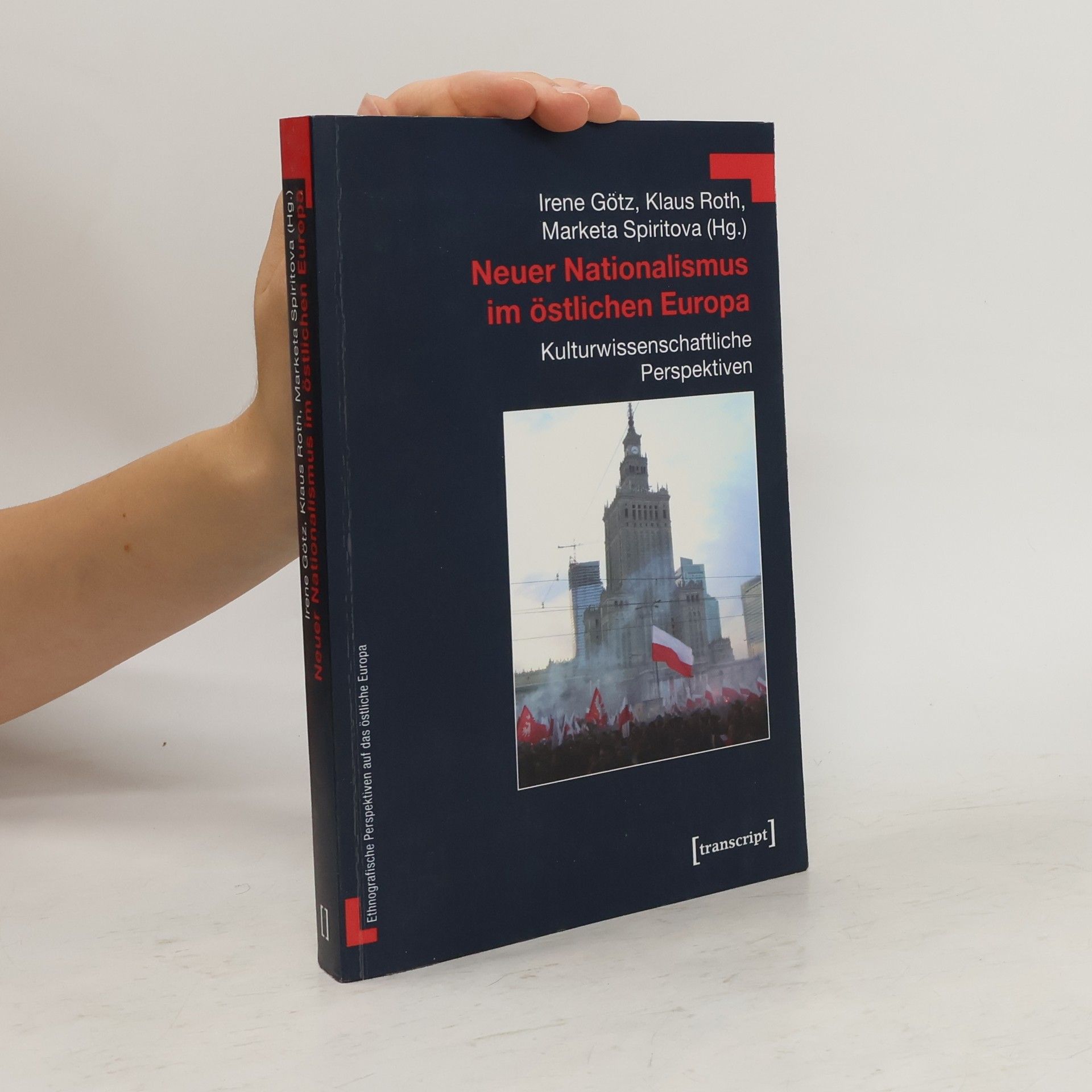Kein Ruhestand
Wie Frauen mit Altersarmut umgehen
Frauen sind im Alter oft von Armut bedroht, insbesondere in Städten mit hohen Mieten. Wie meistern sie das Leben mit wenig Geld? Welche Strategien entwickeln sie, um am sozialen und kulturellen Leben teilzuhaben? Frauen aus verschiedenen sozialen Milieus berichten darüber und verdeutlichen die dringend notwendige politische und gesellschaftliche Veränderung unserer Sozialsysteme. Die 85-jährige Maiana D. lebt von 222 Euro Rente und Grundsicherung, während die ehemalige Lagerarbeiterin Jovana F. mit 600 Euro Rente und Zeitungsverkauf ihren Lebensunterhalt aufbessert. Auch Walburga K., eine Verlagsangestellte, muss zu ihrer Rente von 1170 Euro hinzuverdienen. In einem DFG-Forschungsprojekt unter der Leitung von Prof. Irene Götz wurden fünfzig Frauen zwischen 63 und 85 Jahren interviewt. Diese Bestandsaufnahme zeigt die Ursachen der Altersarmut bei Frauen und ihre praktischen sowie emotionalen Bewältigungsstrategien. Trotz ihrer bescheidenen Renten, die kaum zum Nötigsten reichen, haben viele Frauen gelernt, mit Mangel zu wirtschaften. Armut im Alter muss nicht den Verlust von Lebensqualität bedeuten: Frauen sind oft erfinderisch, sozial kompetent und gut vernetzt. Autonomie bleibt für sie bis zum Schluss wichtig. Das Buch beleuchtet die politischen, gesellschaftlichen und persönlichen Verhältnisse und bietet im Anhang wichtige Informationen zur Unterstützung für Frauen in Not.