Was muss man wissen, um heute mitreden zu können? Diese Frage haben sich Journalisten der ZEIT zusammen mit Bildungsforschern des Leibnitz-Instituts Kiel gestellt. Sie entwickelten einen Katalog von 200 Fragen aus den Bereichen Politik, Wissen, Wirtschaft, Feuilleton, Unterhaltung und Reisen – einen aktuellen Bildungskanon. Was wissen Sie? Testen Sie sich selbst!
Thomas Kerstan Knihy
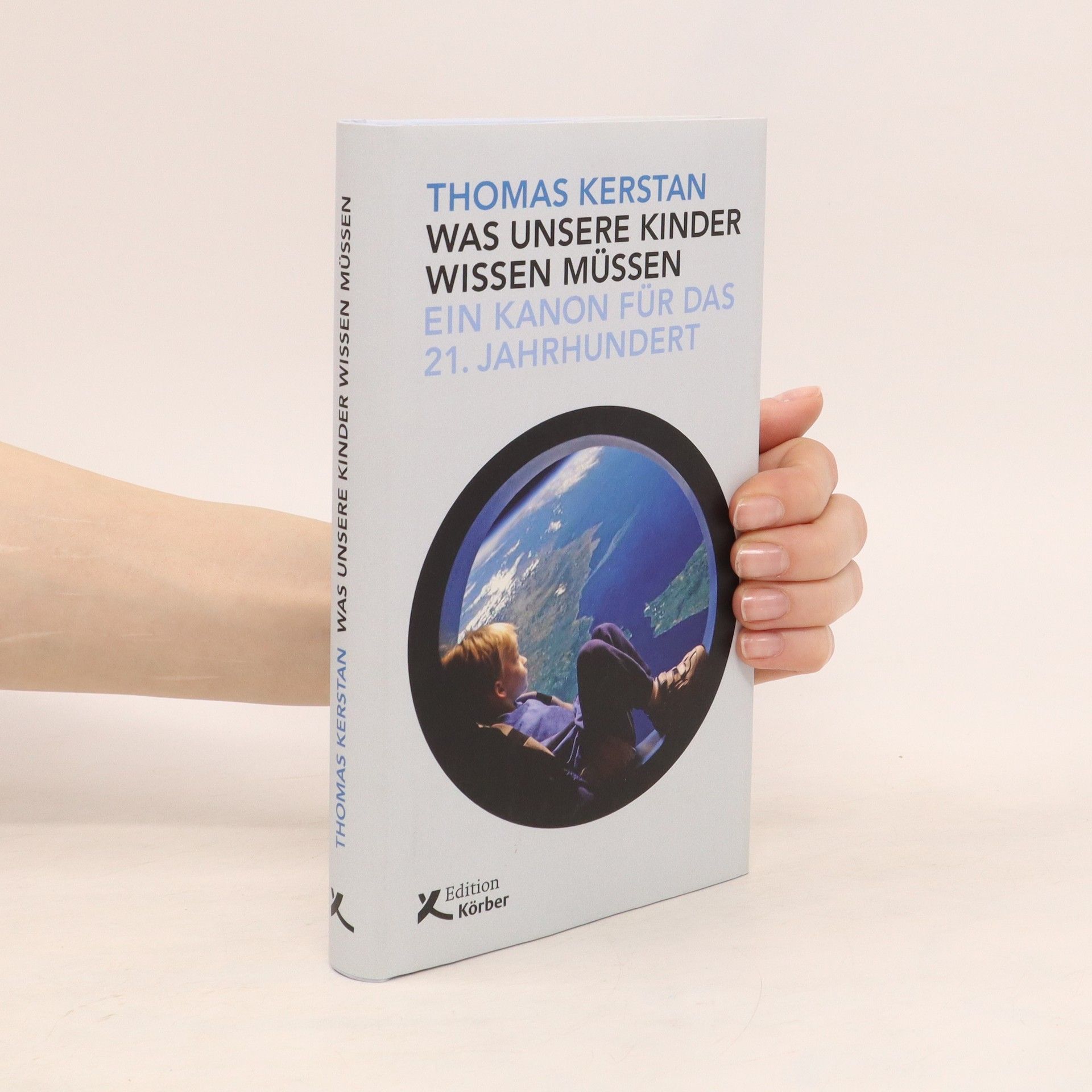
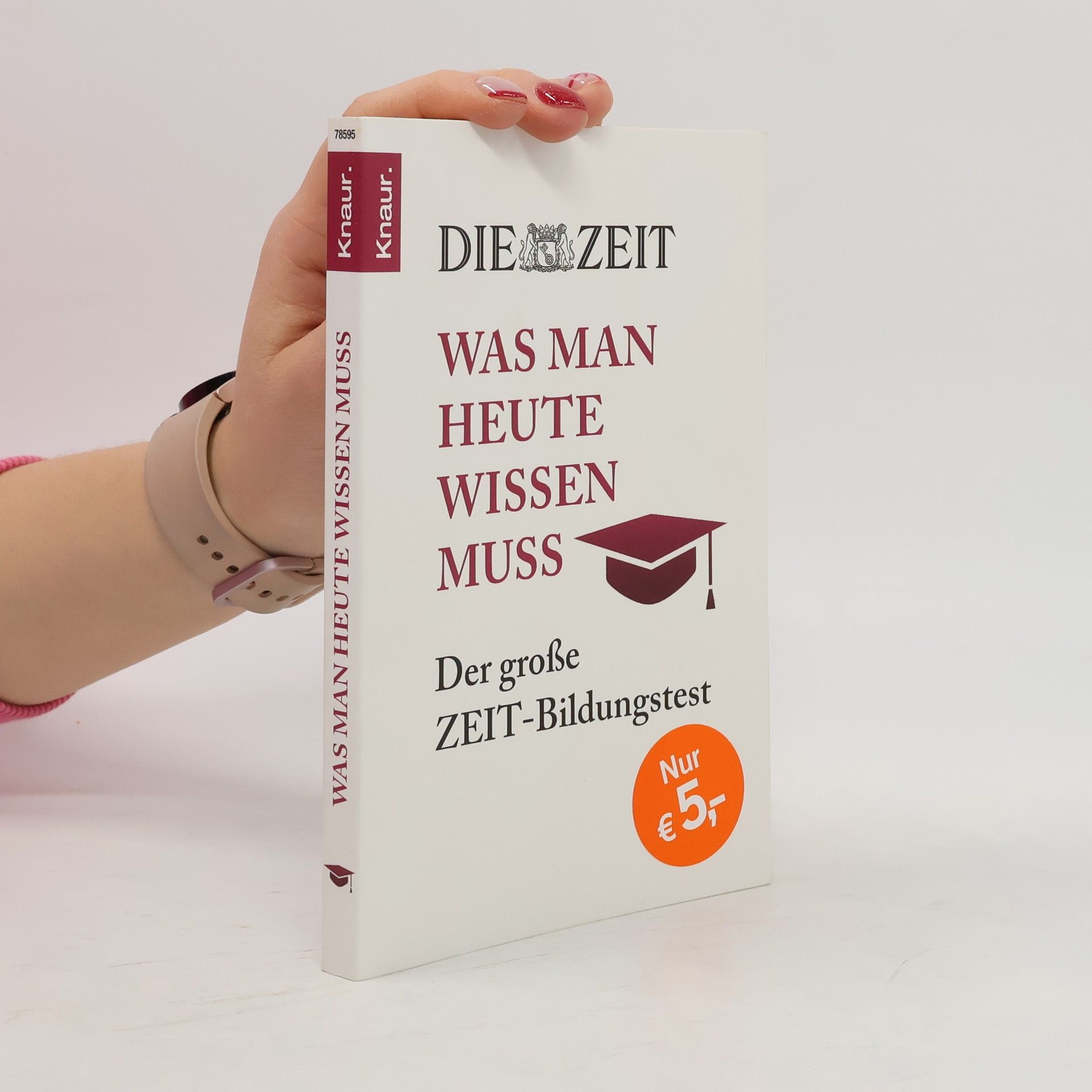
Von Abendlied bis Zahlenteufel: 100 Werke, die man kennen muss Seit Jahren wird bis zum Überdruss über Strukturen und Formendes Lernens gestritten. Das geht aber am Kern der Sache vorbei, erklärt Thomas Kerstan, Bildungsredakteur der ZEIT. Stattdessen muss wieder über die Inhalte diskutiert werden. Kerstan begreift Bildung als den Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält: Indem wir uns über das verständigen, was wissenswert ist, definieren wir zugleich die Leitplanken unseres Zusammenlebens. Hundert Werke, die unsere Kinder – und nicht nur die – kennen müssen, stellt Thomas Kerstan kurz und unterhaltsam vor. Hundert Werke aus Musik, Mathematik und Malerei, aus Literatur und Naturwissenschaft, aus Geschichte, Philosophie und Politik. Bücher sind ebenso darunter wie Filme, TV-Serien, Songs, Gemälde oder Fotos. Mit seinem Kanon öffnet Thomas Kerstan den Blick für die Breite der Allgemeinbildung. Er will dazu inspirieren, sich einmal auf die Relativitätstheorie einzulassen, ein Computerspiel kennenzulernen oder die Geschichte unseres Landes aus anderen Blickwinkeln zu entdecken. Oder ganz allgemein: Wissenslücken zu schließen. Und er lädt dazu ein, in Schulen, der Familie und mit Freunden darüber zu diskutieren, welche Bildung uns wichtig ist und was wir für eine gute Zukunft wissen müssen.