Musikhören in therapeutischer Methodik verband sich im 20. Jahrhundert über Möglichkeiten der technischen Moderne mit Hoffnungen auf neue Wege in der Heilkunst. Diese Hoffnungen sind zum Lebensthema der US-amerikanischen Musikerin und Musiktherapeutin Helen Lindquist Bonny (1921–2010) geworden: Als Violinistin entwickelte sie zunächst eine Expertise für Musik der klassisch-romantischen Ästhetik, bevor sie musiktherapeutisch aktiv wurde und dann mit Guided Imagery and Music (GIM) ein musikrezeptives Methodenwerk entwarf. Ihr Lebensweg war verbunden mit Bestrebungen weiblicher Emanzipation und der Rezeption eines Zeitgeistes, in dem die Auseinandersetzung mit Formen veränderter Wachbewusstheit faszinierte. Musikreisen in innere Räume eröffnet an ihrer Biographie ein Panorama zur frühen Fachgeschichte der rezeptiven Musiktherapie im 20. Jahrhundert.
Dorothea Dülberg Knihy

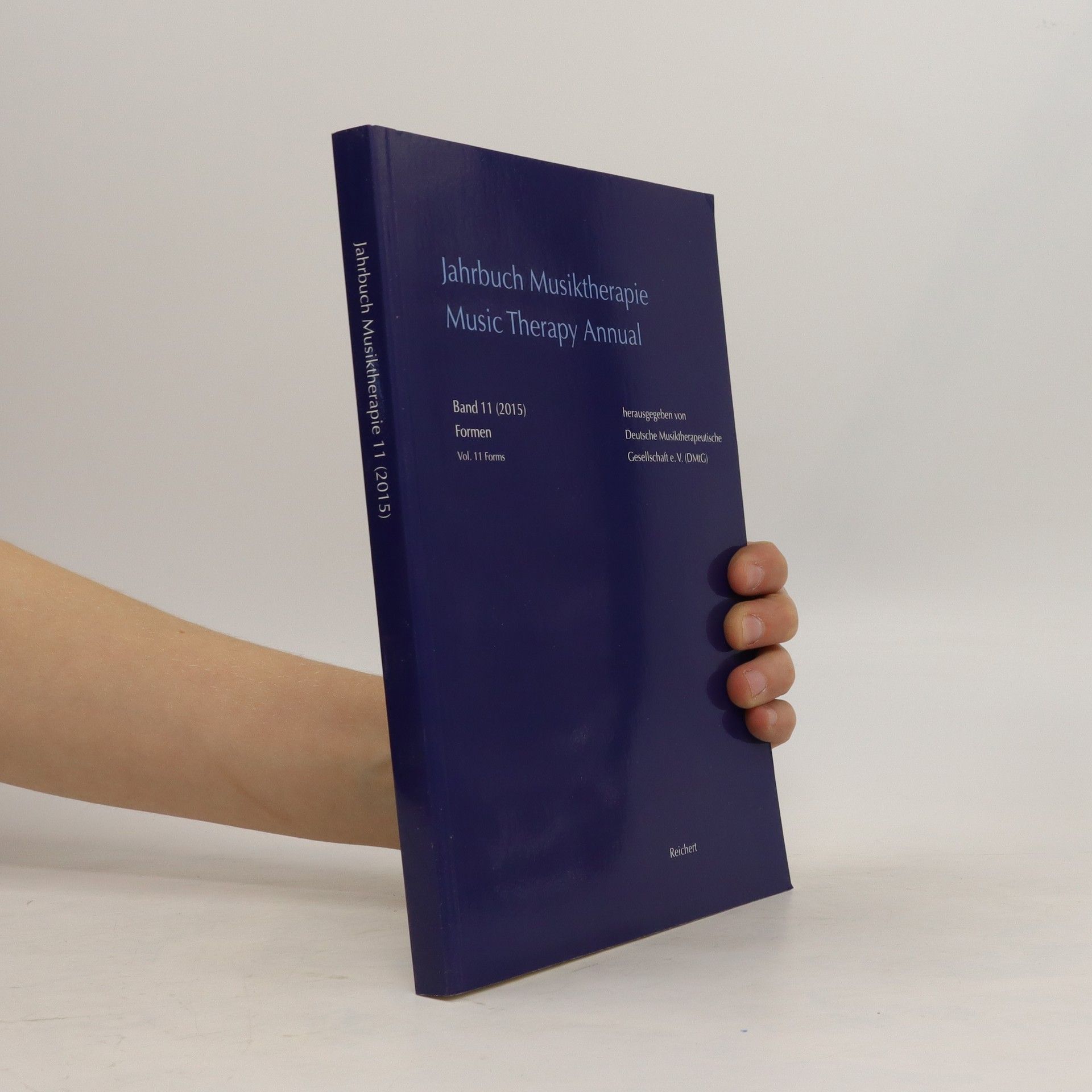

Die eingereichten Artikel zum Thema des Buches „Mentalisierung und Symbolbildungen“ könnten Antworten auf diese und ähnliche Fragen geben. Aus den nun tatsächlich vorliegenden Aufsätzen hat sich ein Schwerpunkt herauskristallisiert: die Mehrheit der Beiträge befasst sich überwiegend mit dem Mentalisierungskonzept– allerdings aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln. Die Buchrezensionen, die wir den Beiträgen nachfolgen lassen, sind hingegen sehr gemischt– sie scheinen eine in dieser Zeit herrschende rege Diskussion zu diesem Themenkreis wiederzugeben. Durch die Summe der verschiedenen Arbeiten wird das Mentalisierungskonzept hinreichend erklärt.