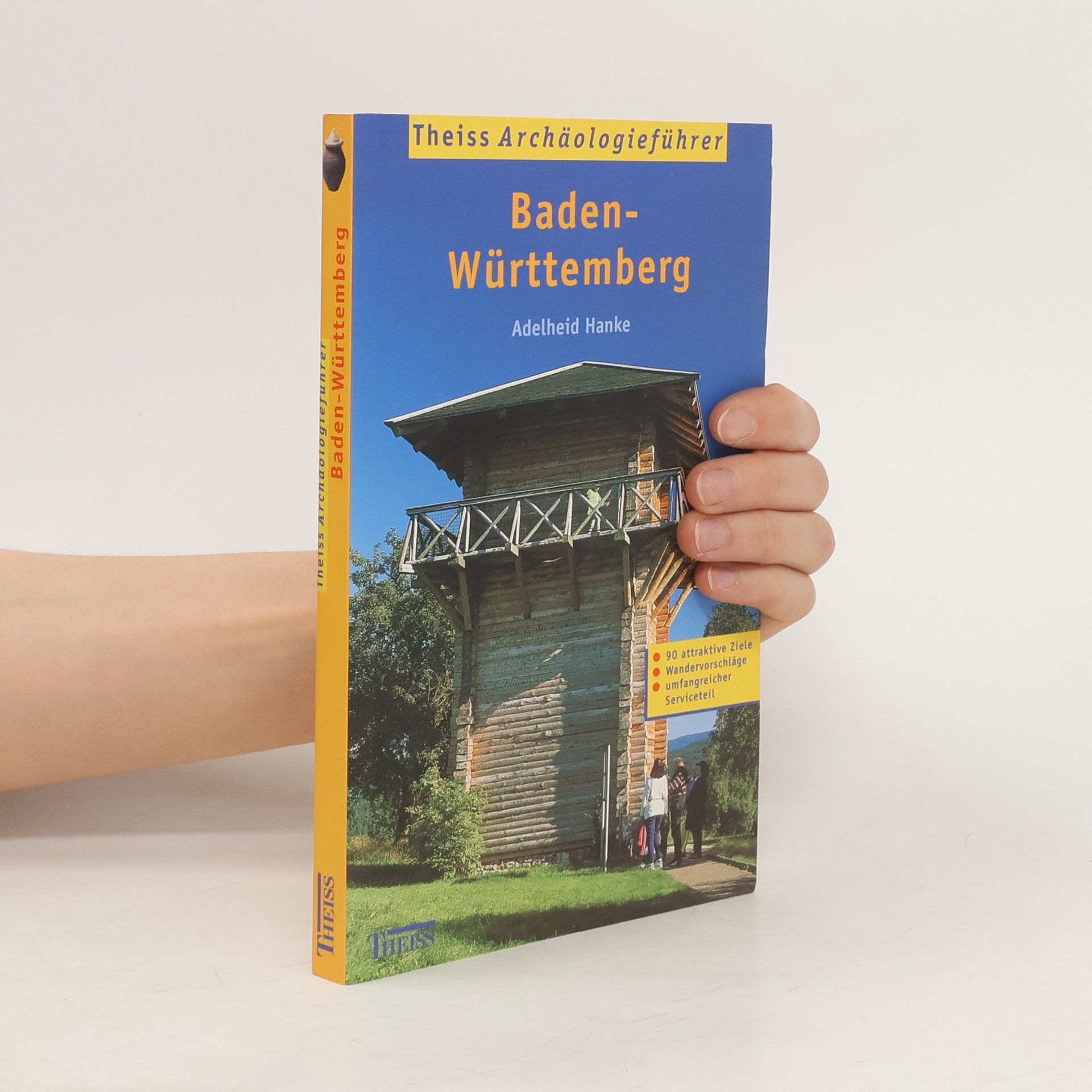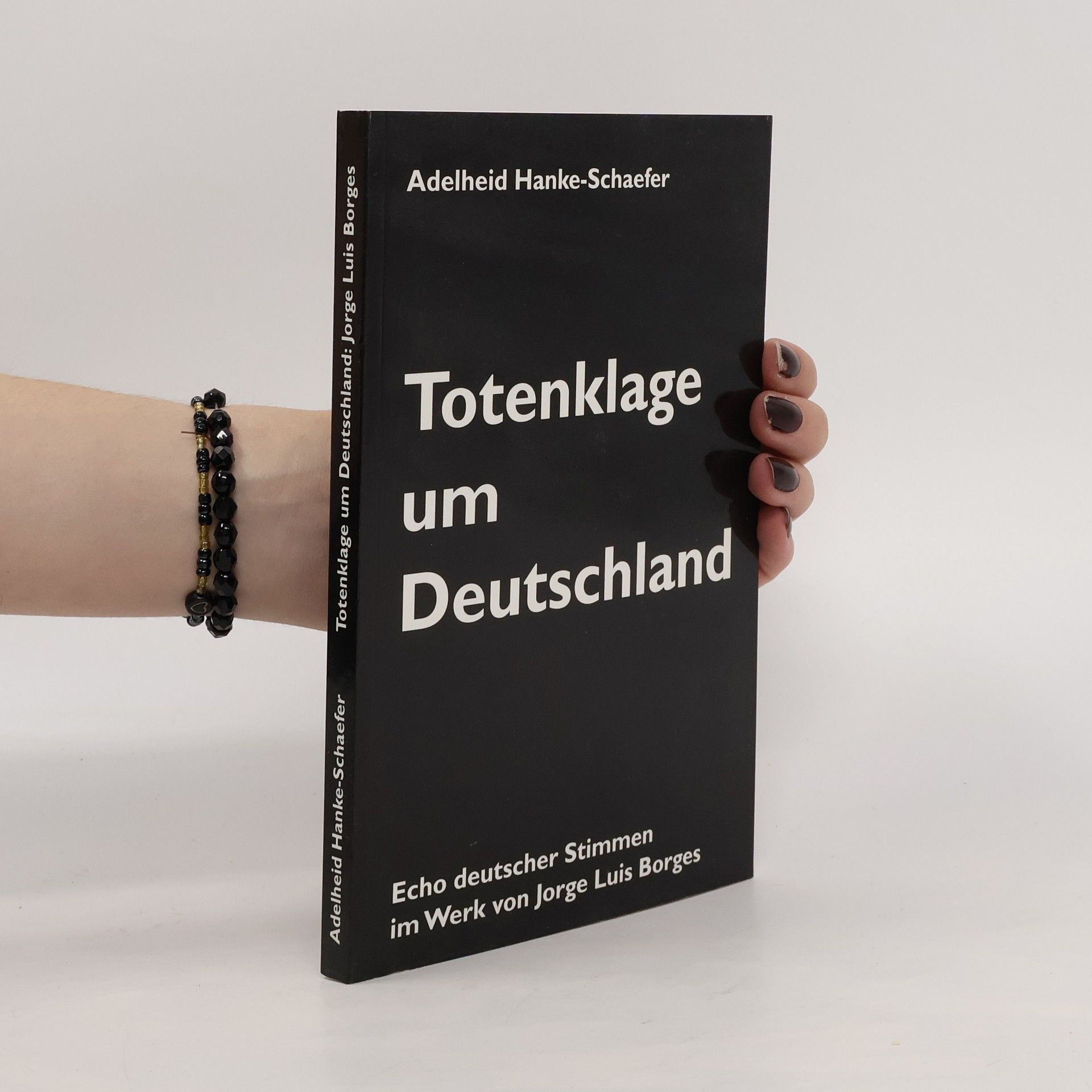Totenklage um Deutschland
- 171 stránok
- 6 hodin čítania
In der Zeitschrift Sur analysierte Borges 1941 die Greuel des Krieges als „irreparable Banalität“, eine Einschätzung, die später von Hannah Arendt als „Banalität des Bösen“ modifiziert wurde. Borges begegnete der Bedrohung durch den Nationalsozialismus mit Worten und Aufklärung, blieb jedoch der deutschen Kultur, die ihm seit seiner Schulzeit in Genf vertraut war, eng verbunden. Er verehrte Brahms, dessen Werk den Titel seiner Erzählung Deutsches Requiem prägte, und betrachtete Schopenhauer als geistigen Vater. Zudem war er ein Kenner der Schriften Nietzsches und las Gedichte von Heinrich Heine auf Deutsch. Kafka hielt er für den bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Die Inhalte umfassen Borges' Beziehung zur deutschen Sprache und Literatur, einschließlich seiner Lektüre von Heine, Meyrink, Kafka sowie seinen Essays über Antikriegsliteratur und die Zensur in deutschen Literaturgeschichten. In Sur veröffentlichte er Beiträge wie „Una pedagogía del odio“ und „La guerra en América“. Zudem wird Borges’ Fiktion im Kontext des Holocaust untersucht, einschließlich der rhetorischen Strategien in Deutsches Requiem und der Reflexion über Schopenhauer. Konzepte utopischen Denkens werden ebenfalls behandelt, wie in „Utopía de un hombre que está cansado“.