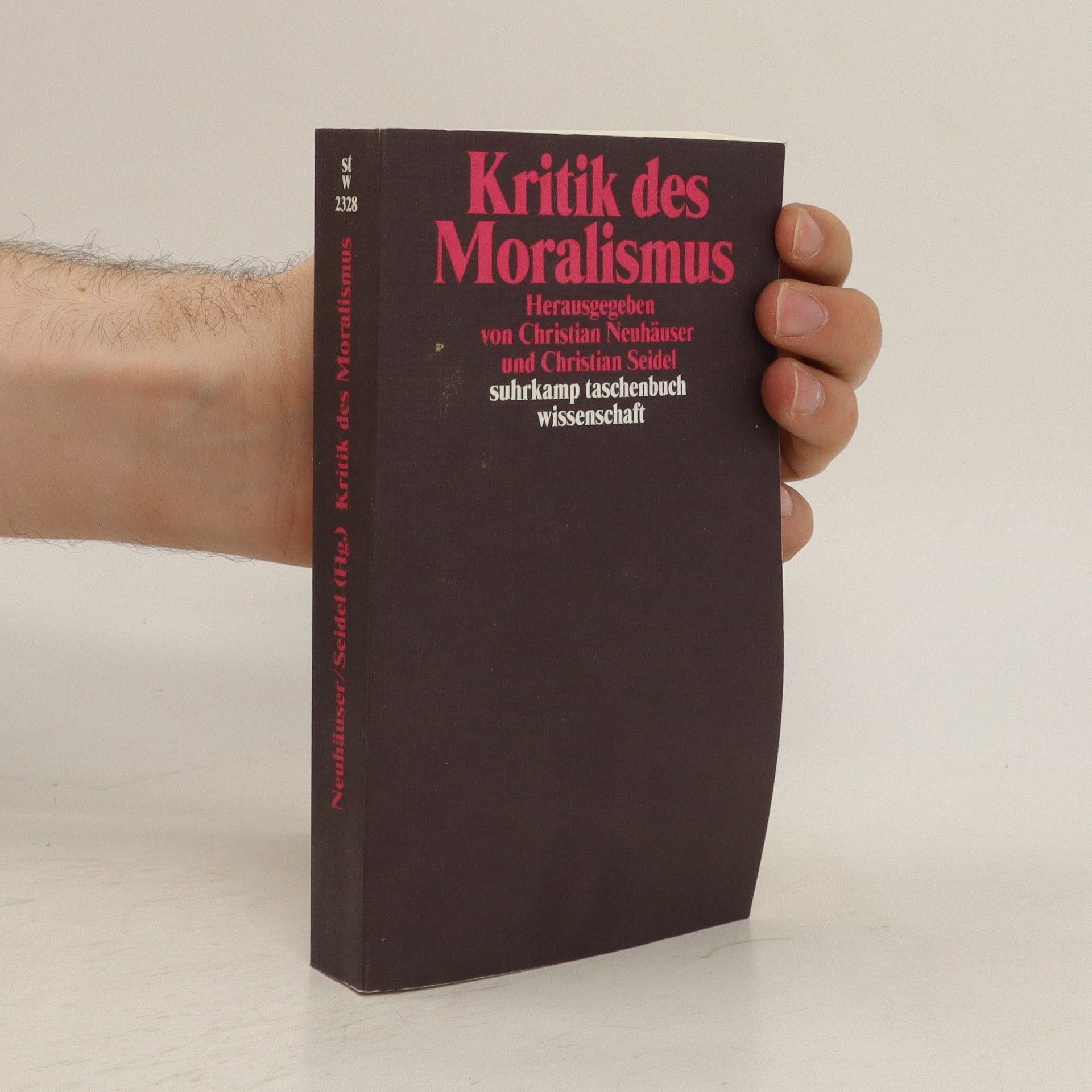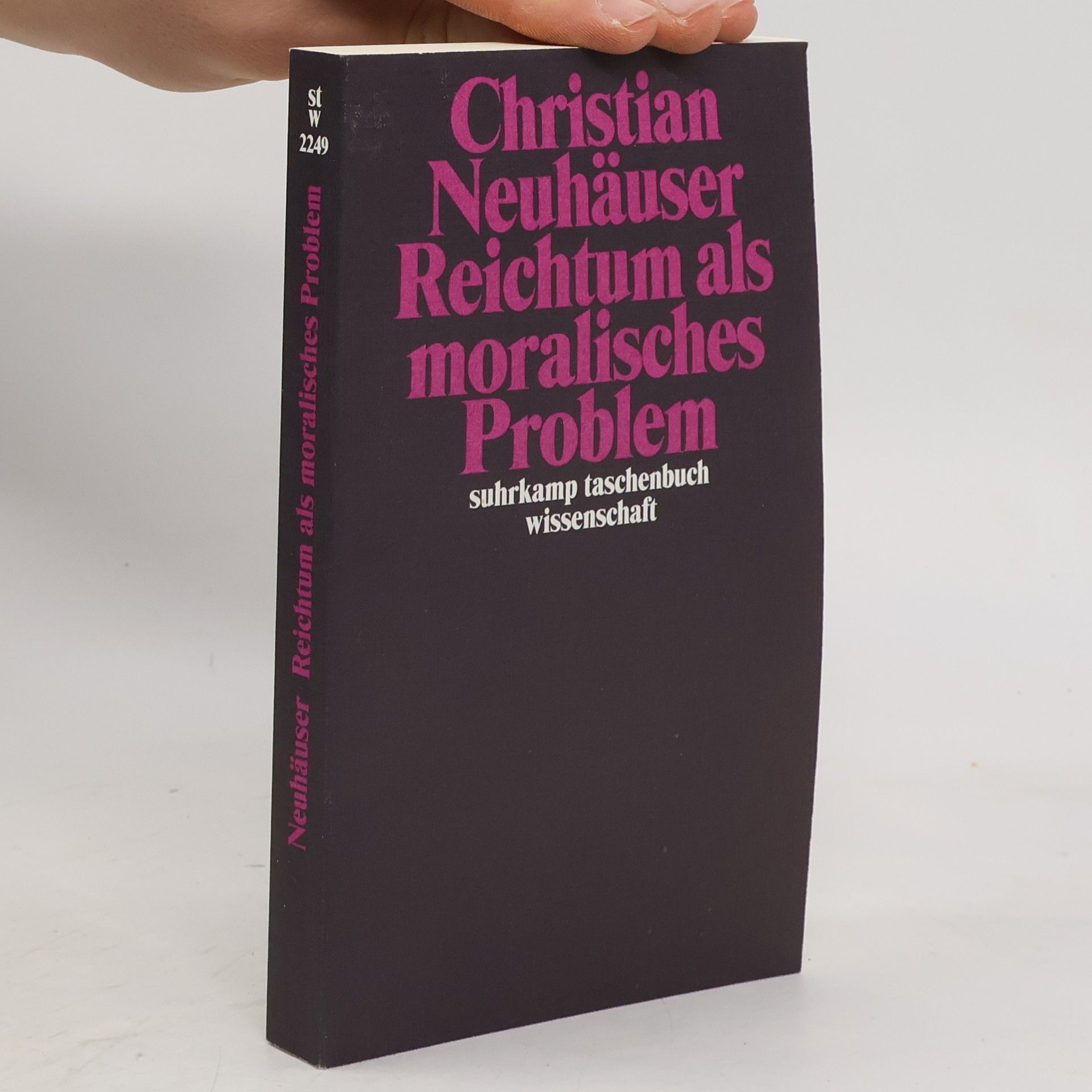Reichtum als moralisches Problem
- 281 stránok
- 10 hodin čítania
Reichtum gilt als gut, sogar als begehrenswert. Selbst wer nicht nach ihm strebt, würde ihn kaum zurückweisen, und wer anderen ihren Reichtum nicht gönnt, gilt schnell als neidisch. Christian Neuhäuser stellt in seinem neuen Buch solche Selbstverständlichkeiten in Frage und behauptet: Man kann nicht nur reich, man kann auch zu reich sein. Er zeigt, dass das gesellschaftliche Streben nach immer mehr ein Zusammenleben in Würde gefährdet, und argumentiert für einen Umgang mit dem erreichten Wohlstand, der deutlich verantwortungsvoller ist als derjenige, den wir gegenwärtig pflegen.