Upcycle newspapers, advertising flyers, brochures, and other waste paper into decorative and functional baskets, cushions, organizers, and more.
Dorothea Schmidt-Supprian Poradie kníh
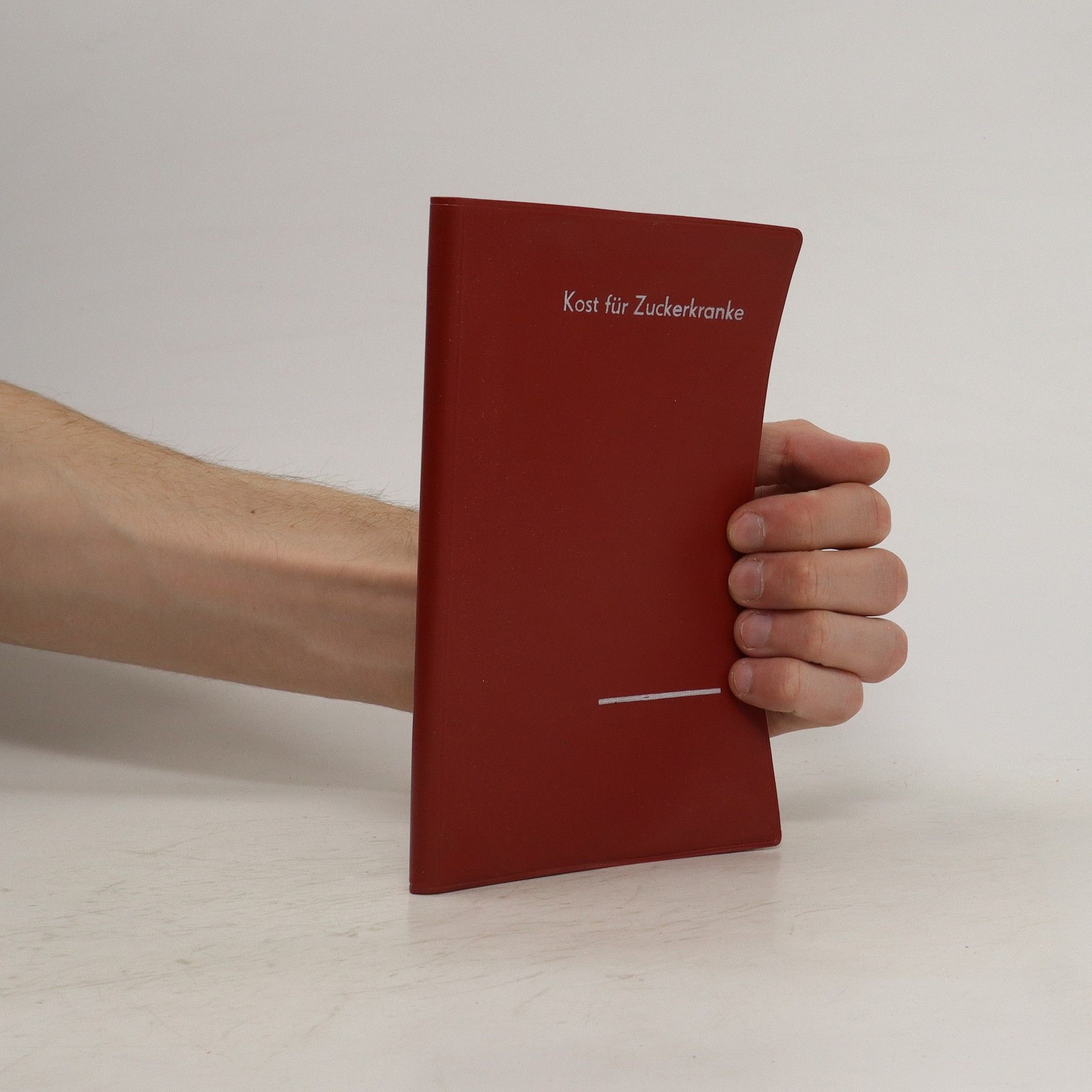





- 2024
- 2022
Die Pappmaché-Werkstatt
Modellieren mit Papier, Wasser und Kleister
Papier-Upcycling Nach dem Erfolgsbuch »Paper Baskets« beeindruckt Dorothea Schmidt nun mit ihrem neuen Werk zum Thema Pappmaché. Je nach Bedürfnis stellt sie verschiedene Pappmaché-Rezepte vor und zeigt in ihren Upcycling-Projekten die breite Vielfalt des Materials. Nach einer detaillierten Einführung rund um den Papierteig entstehen Schritt für Schritt zauberhafte Deko-Objekte für das ganze Jahr – traumhafte Windlichter, Gewürzschalen, Schmuck und vieles mehr.
- 2021
Pippi-Langstrumpf-Kirche
Meine Erfahrungen auf dem Synodalen Weg
Dorothea Schmidt ist eine engagierte Katholikin. Sie wird zum Synodalen Weg berufen und kann nicht fen, was sie dort erlebt. Denn was dort piert, ist nicht mehr katholisch. Es hat auch nichts mit Jesus zu tun, sondern ist eine Anbiederung an den „Ich mach mir die Kirche, wie sie mir gefällt“ – Pippi Langstrumpf auf katholisch. Sie braucht aber keine Fantasy-Kirche liberaler Kirchenträumer. Die braucht niemand.
- 2021
Paper Baskets
Körbe, Accessoires und Deko-Ideen aus Altpapier
In jedem Zeitungsstapel steckt ein potenzieller Korb! Ein praktischer Ratgeber zur Technik des Korbflechtens neuartig, nutzwertig, nachhaltig. Korbflechtprofi Dorothea Schmidt erklärt in einfachen Anleitungen, wie man mit ein paar Zeitschriften, einer Schere, einem Klebestift und einem Schaschlikspieß schönes Flechtwerk herstellt: Körbe, Vasen, Obstschalen, Teelichtbehälter, Tabletts und noch vieles mehr. Praktische Alltagsgegenstände, die an Nachhaltigkeit und Kreativität kaum zu überbieten sind.
- 1990
Durch den Tag
- 16 stránok
- 1 hodina čítania
Rare Book
- 1990
