Die normative Ethik behandelt die Frage, was wir in moralischer Hinsicht tun sollen. Die Metaethik fragt grundlegender: Was bedeutet es überhaupt, dass wir etwas in moralischer Hinsicht tun sollen? In dieser Einführung werden einige prominente Theoriengruppen der Metaethik vorgestellt, die jeweils ganz unterschiedliche Vorschläge unterbreiten, wie man den Status der Moral deuten sollte. Dabei werden zum einen deren Ausgangsmotivation und Grundidee zur Sprache gebracht und zum anderen deren Überzeugungskraft und Potenziale kritisch eingeschätzt. Thematisch diskutiert der Band verschiedene Schlüsselkontroversen, zum Beispiel die Frage nach der Objektivität der Moral, die Debatte um die Rekonstruktion der moralischen Motivation und den Diskurs um die Möglichkeit einer Naturalisierung der Ethik.
Markus Rüther Knihy



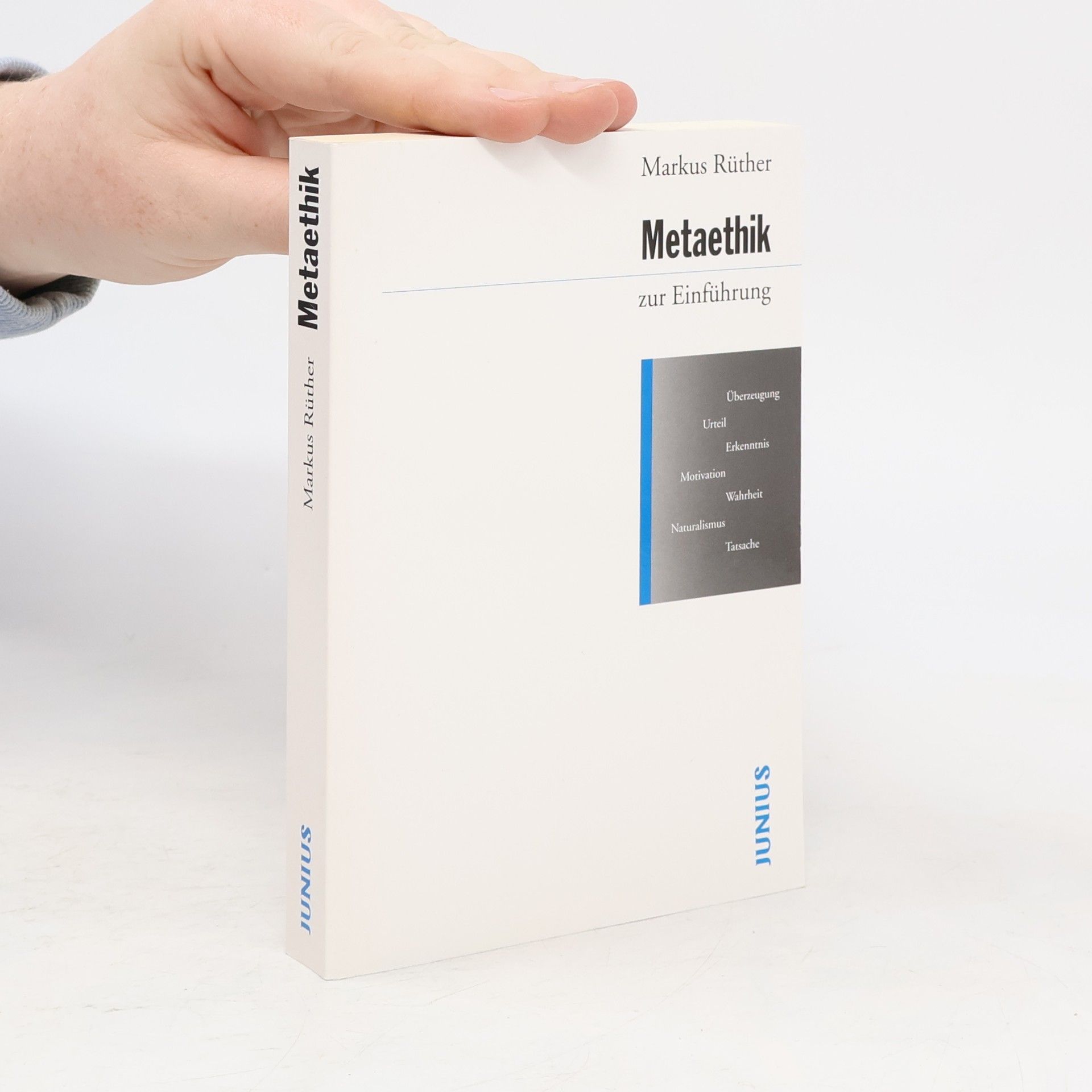
Technologische Selbstoptimierung ist gegenwärtig in aller Munde. Sie umfasst die Erforschung neuer Möglichkeiten im Hinblick auf Schönheitsoperationen, funktionale Implantologie, Gehirndoping oder die Verlängerung der Lebensspanne. Gegenüber vielen dieser technischen Mittel, die oft nicht legal verfügbar sind, bestehen erhebliche gesellschaftliche Vorbehalte. Jan-Hendrik Heinrichs und Markus Rüther plädieren bei ihrer ethischen Einschätzung für eine Differenzierung der Perspektive: Die Vorbehalte sind nämlich ihrer Meinung nach nicht geeignet, gesellschaftliche Ächtung oder gar verbindliche Verbote für alle zu begründen. Vielmehr habe die Freiheit zur Selbstgestaltung Vorrang, was jedoch nicht heißt, dass es für manche Bereiche nicht auch klare Regeln geben muss. Weil Selbstgestaltung aber nur frei sein kann, wenn sie informiert ist, argumentieren die Autoren für Regelungen, die von weitgehenden Informationspflichten statt von Verboten bestimmt sind. Aus einer individuellen Sicht heraus lassen sich zudem eine Reihe von moralischen Empfehlungen formulieren, die zwar nicht eingefordert werden können, aber einen ethischen Kompass bilden, um sich im Dickicht der ethischen Debatte an guten Gründen zu orientieren.
Sinn im Leben
Eine ethische Theorie
Was treibt Menschen an, Tag für Tag aufzustehen und zur Arbeit zu gehen? Warum finden wir es wichtig, viel Zeit mit Partner, Familie oder Freunden zu verbringen? Wie lässt sich erklären, dass Menschen Zeit opfern, um andere Menschen etwa im Rahmen einer Freiwilligenarbeit zu unterstützen? Diese und weitere Fragen werden in der Ethik gegenwärtig unter dem Titel „Sinn im Leben“ diskutiert. Der Philosoph Markus Rüther knüpft an diese internationalen Diskussionen an und macht das Thema erstmals in deutscher Sprache zum Gegenstand einer umfassenden Reflexion. Er entwickelt eine neuartige und originelle Sinntheorie, die in ihrer Differenziertheit und Überzeugungskraft über die bisher vorgelegten Angebote hinausgeht.