Aschendorff Verlag Knihy




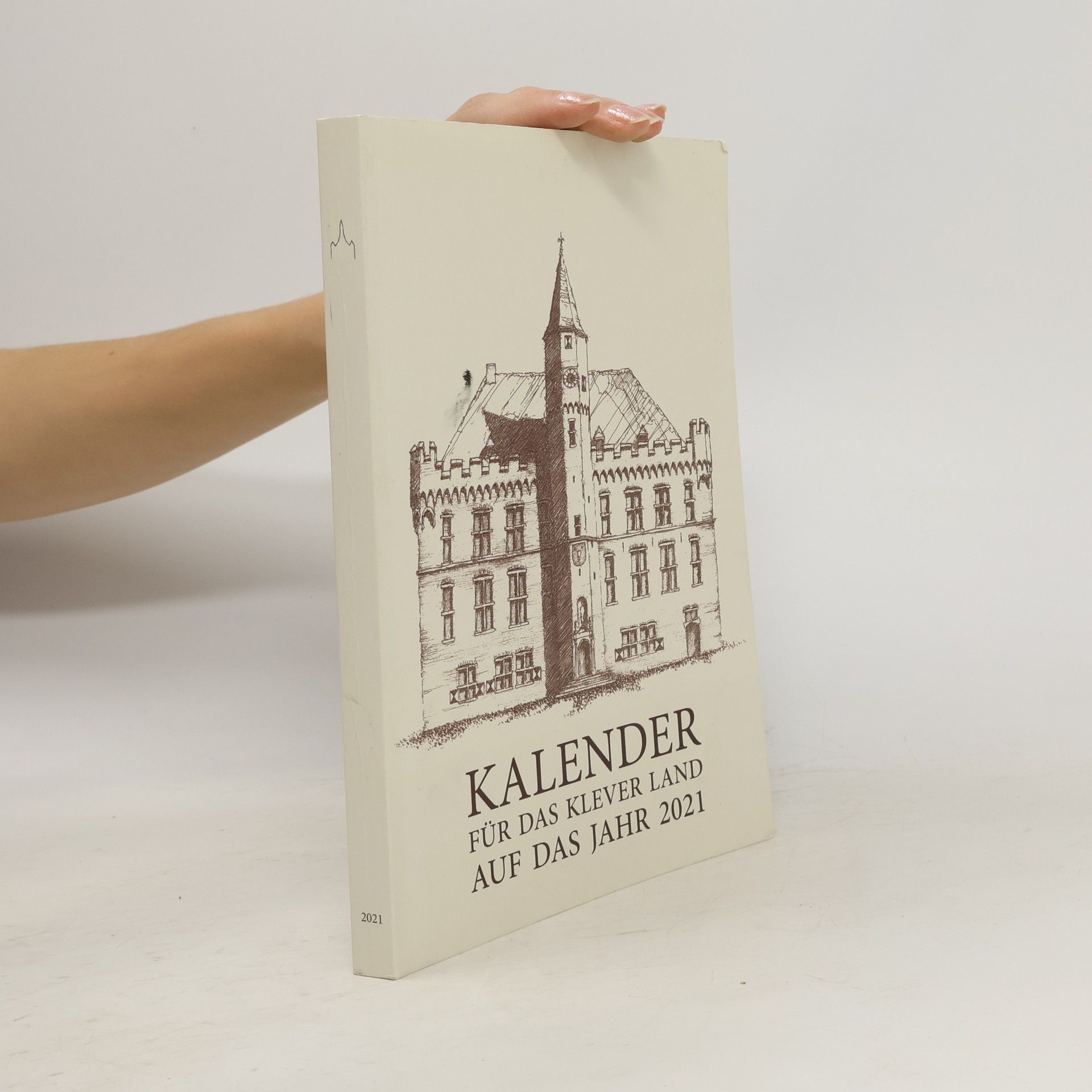
Heimat Dortmund 1/2021
Brennende Ruhr Stadtgeschichte in Bildern und Berichten
1923 war ein Jahr der Krisen in der noch jungen deutschen Demokratie. Die Republik kämpfte gegen Aufstände von links und Putschversuche von rechts, sowie gegen eine immer weiter fortschreitende Inflation. Ihren Ausgangspunkt haben die Ereignisse des Krisenjahres 1923 im Konflikt um die deutschen Reparationsleistungen, der schließlich ab Januar 1923 in der französischen Besetzung des Ruhrgebietes seinen Höhepunkt fand. Die vorliegende Ausgabe beschreibt damit ein deutschlandweit aber auch gerade für die Dortmunder Stadtgeschichte bedeutsames Thema, so waren die Ruhrbesetzung bzw. ihre direkten und indirekten Folgen doch von großer Sie waren ein Mosaikstein im Scheitern der Weimarer Republik und der Machterschleichung der Nationalsozialisten. Als Titel des Heftes diente der Roman „Brennende Ruhr“ von Karl Grünberg (1891 – 1972) von 1928 als Vorbild. Der Roman beschreibt die Zeit des Kapp-Putsches und wurde, wie viele andere Werke des kommunistischen Schriftstellers auch, bei der Bücherverbrennung der s am 10. Mai 1933 ein Opfer der Flammen.
2019 feierte die Essener Volkshochschule (VHS) ihren 100. Geburtstag. Der 132. Band der Essener Beitrage (Beitrage zur Geschichte von Stadt und Stift Essen), die seit 1880 vom Historischen Verein fur Stadt und Stift Essen e. V. herausgegeben werden, bietet eine ausfuhrliche Chronik der VHS und dokumentiert das ereignisreiche Jubilaumsjahr. Unter den Vorzeichen von Demokratie und Rechtstaatlichkeit wurden ab 1919 politische und kulturelle Grundmaximen wie Frieden, Toleranz, Respekt, Weltoffenheit oder Pressefreiheit begrundet. Aufsatze zum "Essener Gruppensystem", zur Einfuhrung des Frauenwahlrechts, zur Entstehung des "Bundes" (Bund. Gemeinschaft fur sozialistisches Leben) oder zu herausragenden Beispielen des Neuen Bauens (Sudwestfriedhof, Kirchenbauten Otto Bartnings) stehen fur die "Aufbruche" der Weimarer Republik. Die faszinierende Bandbreite der Essener Stadtgeschichte von der Urzeit bis in die Gegenwart zeigt sich u. a. in einem Aufsatz uber die Essener Abtissin Theophanu, eine Enkelin Kaiser Ottos II.
Die Bauten und Entwürfe des Architekturbüros Pfeifer & Großmann zeugen noch heute von der Kreativität und planerischen Phantasie der beiden Architekten. Arthur Pfeifer (1879-1962) und der Schweizer Hans Großmann (1879-1949) schlossen sich 1905 in Karlsruhe zu einem gemeinsamen Architekturatelier Pfeifer & Großmann zusammen und konnten schon bald in der Karlsruher Architekturszene aus Hermann Billing, Wilhelm Vittali oder Curjel & Moser und anderen Erfolge verzeichnen. Mit dem beachtlichen Bau des Rathauses in Mülheim an der Ruhr 1911-1916 entstand dort eine zweite Niederlassung, die vor allem Hans Großmann bis zu seinem Tod 1949 leitete. Hier entwickelte das Büro weitere bemerkenswerte, stadtbildprägende Arbeiten, Siedlungsplanungen, repräsentative Bauten wie die Mülheimer Stadthalle, Kraftwerke und soziale Einrichtungen. Ausgehend von frühen, von Jugendstil und Klassizismus geprägten Bauten im Badischen nahm vor allem Hans Großmann in seinen Mülheimer Wohn- und Geschäftsbauten Entwicklungen der Architekturmoderne der 1920er Jahre auf. Bisher fehlte eine zusammenfassende Übersicht ihrer beider Werke in Karlsruhe und Mülheim an der Ruhr. Das durchaus beachtenswerte OEuvre von Pfeifer & Großmann soll mit diesem Band gewürdigt werden.
Entschlossen vorangehen!
Ignatianische Spiritualität als Stachel für die ökumenische Praxis