Marie-Luisa Frick untersucht die Aufklärung und deren aktuelle Relevanz angesichts politischer Extreme, religiöser Gewalt und einem Vertrauensverlust in Wissenschaft und Medien. Sie betont, dass Aufklärung kein festes Erbe ist, sondern kontinuierliches, mutiges Denken erfordert. Die Zukunft des Humanismus balanciert zwischen Verzagtheit und Übermut.
Marie-Luisa Frick Knihy
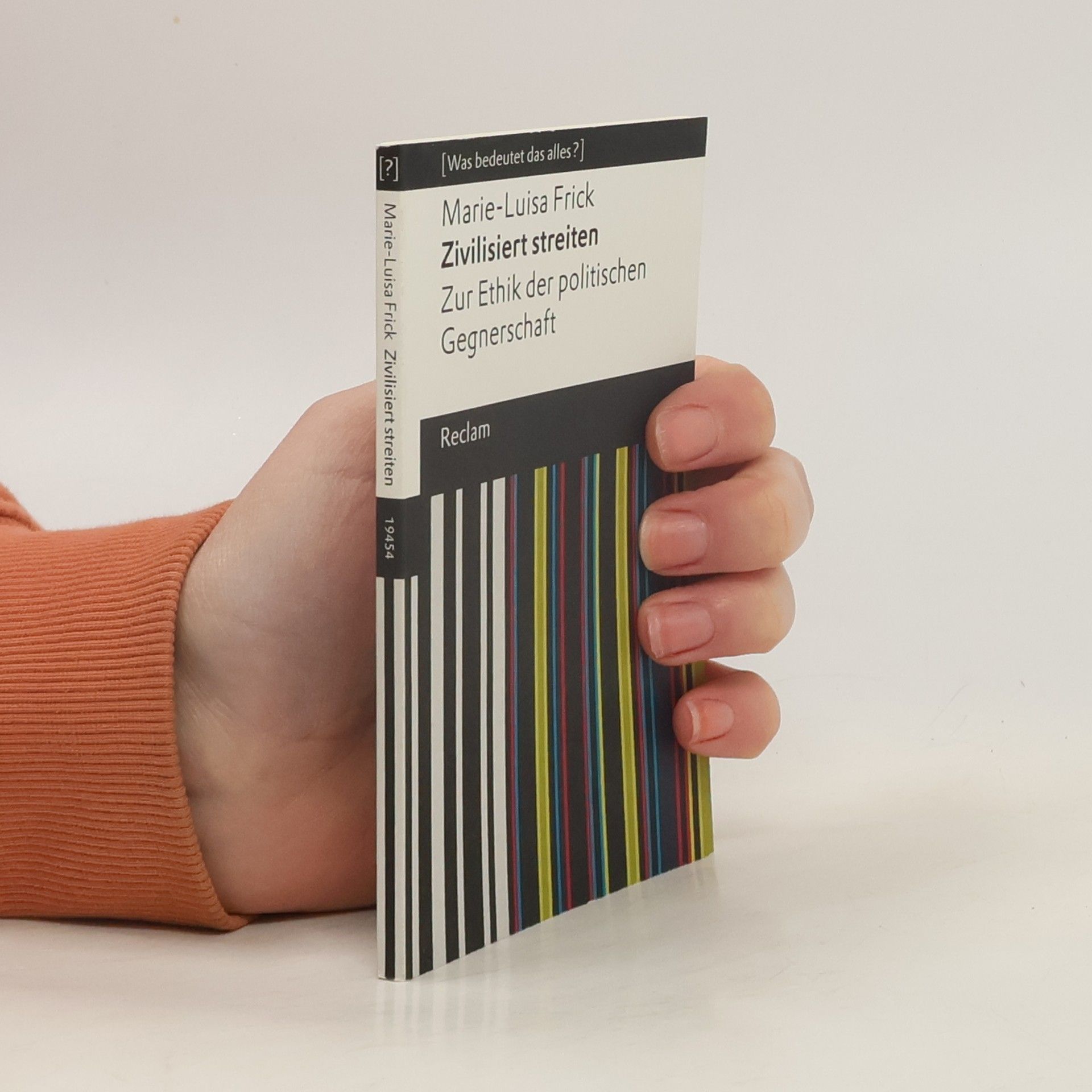
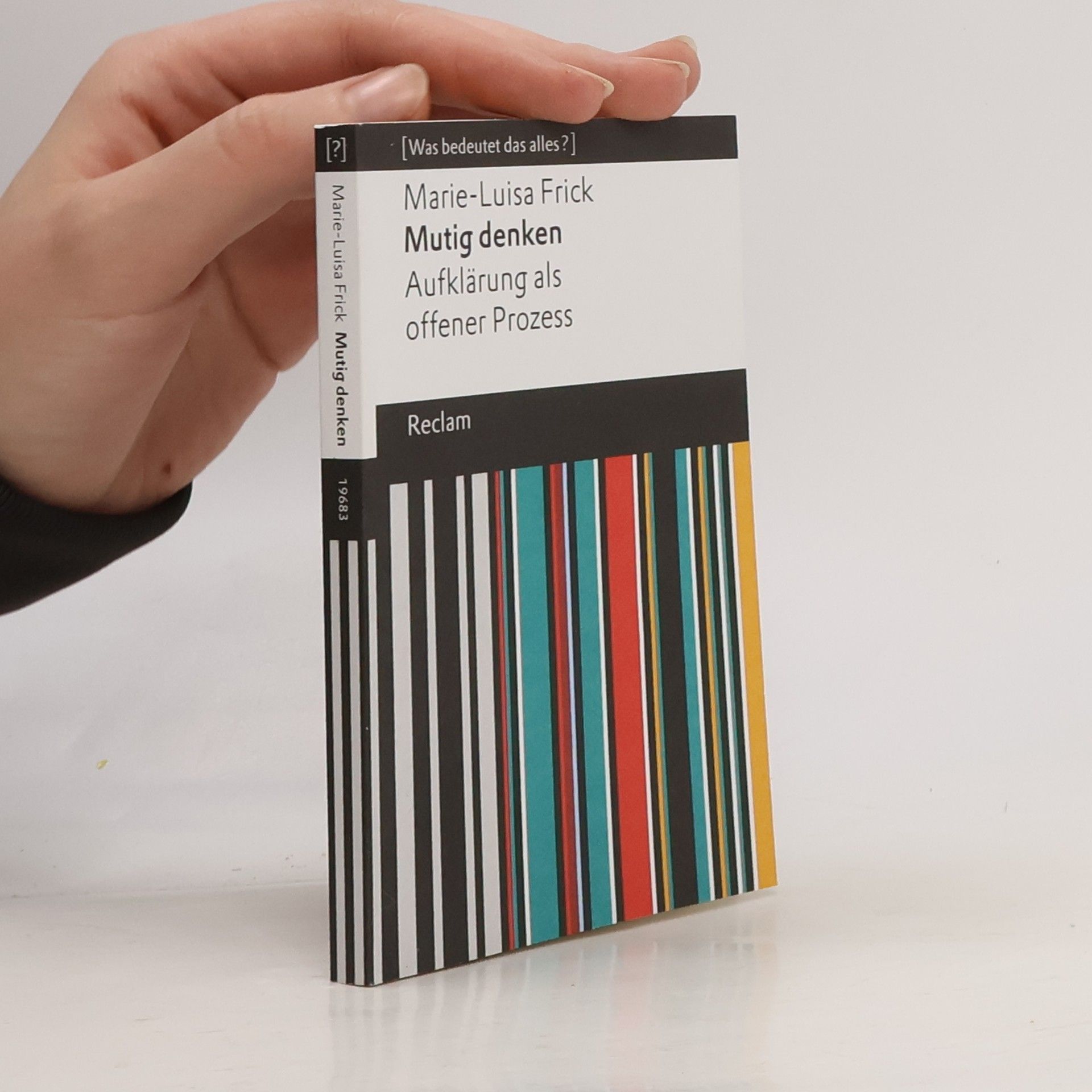
![Mutig denken. Aufklärung als offener Prozess. [Was bedeutet das alles?]](https://rezised-images.knhbt.cz/1920x1920/0.jpg)
Was war die Aufklärung? Ist sie gar am Ende? Das Erstarken politischer Ränder, ansteigende religiöse Gewalt und ein Vertrauensverlust in Wissenschaft und Medien legen dies anscheinend nahe.Marie-Luisa Frick führt durch die Geschichte und spannungsgeladene Normativität aufklärerischen Denkens und zeigt: Aufklärung ist kein »Erbe«, bei dem wir immer schon wüssten, worum es sich handelt. Mutiges und eigenständiges Denken müssen wir uns immer wieder neu erarbeiten und immer wieder neu entdecken.Oder wie Frick es ausdrückt: »Die Zukunft des Humanismus, sie liegt zwischen Verzagtheit und Übermut.«
Was bedeutet das alles?: Zivilisiert streiten
- 94 stránok
- 4 hodiny čítania
Konflikte gehören zum Wesen der Politik, und Strategien erfolgreicher Konfliktlösungen charakterisieren die politische Arbeit. Dabei kann der Zwang zum Konsens das Politische verfehlen. Deshalb fragt eine Ethik des politischen Konfliktes nicht nur danach, wie Konflikte »gelöst« werden können, sondern wie sie ausgetragen werden sollen. Wie darf man mit einem politischen Gegner umgehen? Wie weit soll Meinungsfreiheit reichen in Zeiten von »Hass im Netz« und »politischer Korrektheit«? Was heißt es, Demokratie als wehrhaft zu gestalten? Und was schulden demokratische Mehrheiten der Minderheit – oder Gegnern der Demokratie? Fragen, deren Beantwortung für eine zukunftsfähige Gesellschaft lebenswichtig ist.