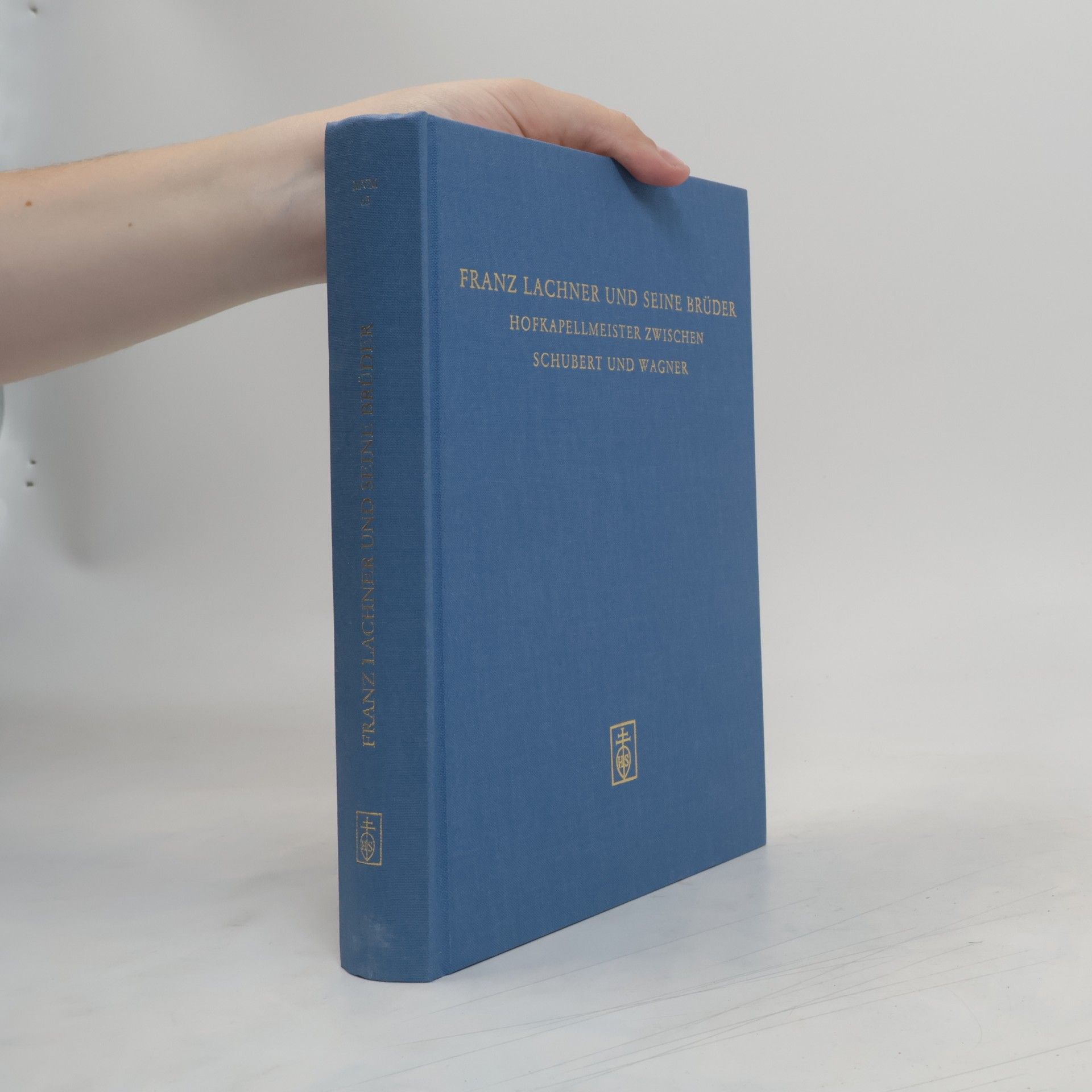Musik in Bayern zur Zeit Napoleons
Bericht über das Interdisziplinäre Symposium, veranstaltet von der Gesellschaft für Bayerische Musikgeschichte, der Hochschule für Theater und Musik München und der Simon-Mayr-Forschungsstelle der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt Ingolstad
"Das Schicksal des im folgenden Jahr zum Königtum erhobenen Kurfürstentums Bayern war seti 1805 eng an das des französischen Kaisers Napoleon gekoppelt. Diese annähernd zehn Jahre brachten Bayern eine Umbruchsphase, an deren Ende die volle staatliche Souveränität stehen sollte. König Max I. Joseph und seine Minister, allen voran Maximilian Joseph Graf von Montgelas, nutzten - ganz im Sinne der modernen Gesetzgebung und Wissenschaftspolitik Napoleons - den Schwung der Rangerhöhung, um die schon zuvor im Geiste der Aufklärung begonnene Reformpolitik voranzutreiben. Sie führte zu dramatischen Veränderungen für das ganze Land. Das Königreich Bayern von 1815 hatte schließlich kaum noch Gemeinsamkeiten mit dem Kurfürstentum Bayern bei Amtsantritt des späteren Königs im Jahre 1799. Die vielfältigen Auswirkungen und Einflüsse Napoleons auf das Musikleben Bayerns zu eforschen, war Gegensand eines Interdisziplinären Symposions, dessen Beiträge im vorliegenden Band zusammengefasst sind"--Back cover