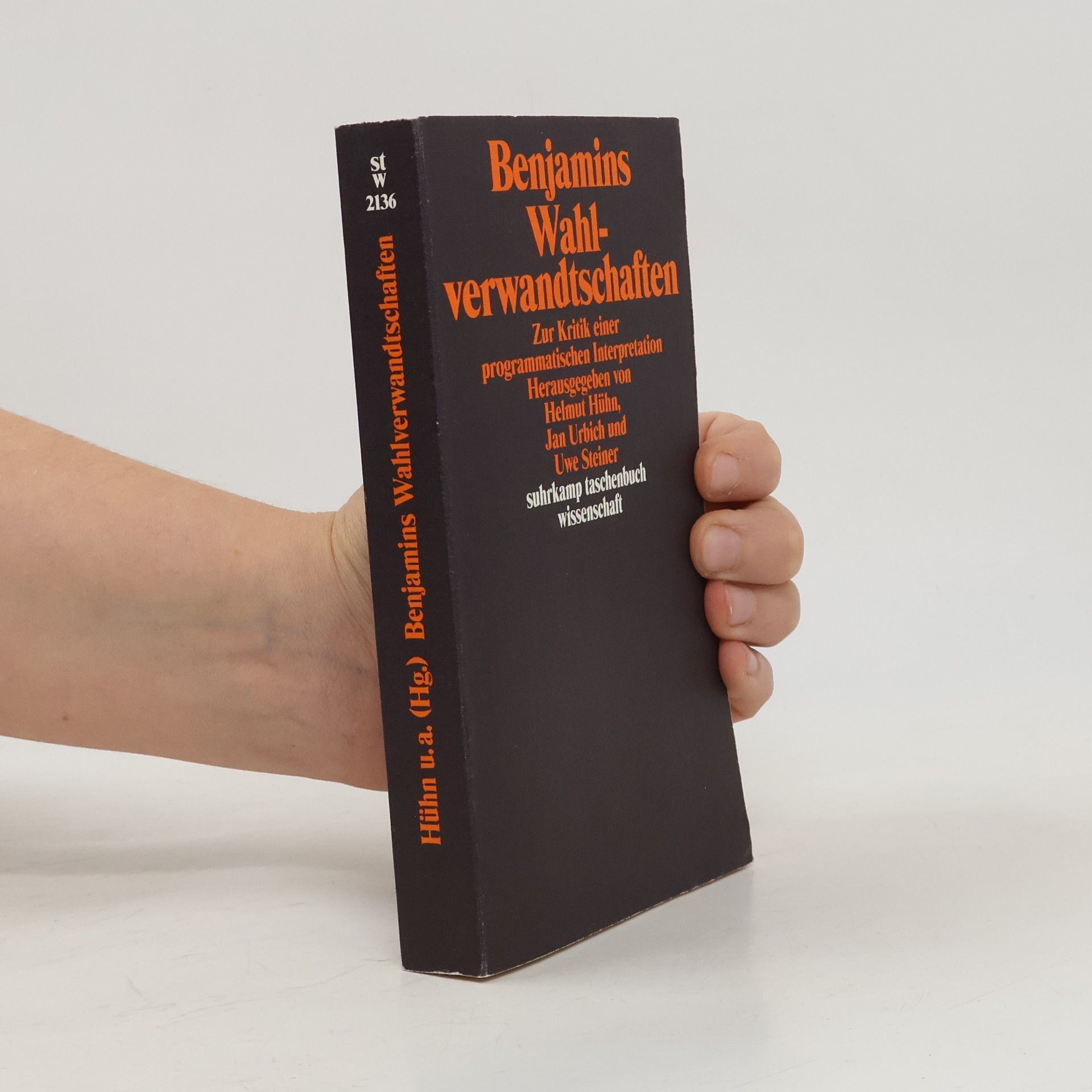Die Entdeckung der Nacht
Wirklichkeitsaneignungen im Prozess der europäischen Aufklärung
- 322 stránok
- 12 hodin čítania
Dunkelheit und Nacht werden in der bildenden Kunst, Literatur und Philosophie des 18. Jahrhunderts intensiv reflektiert. Die Beiträge des vorliegenden Bandes untersuchen die an der Nachtdarstellung sich entfaltenden Spannungen und Konflikte vor dem Hintergrund der Selbstverständigungsprozesse der europäischen Aufklärung. Dabei steht die Korrelation von künstlerischer Vergegenwärtigung der Nacht und epistemischer Erkundung der Wirklichkeit im Zentrum des interdisziplinären Erkenntnisinteresses. 0In den aufgeklärten Wissenschaften werden zunächst vor allem Bedrohungen durch die Nacht thematisiert, der Dunkelheit wird der Kampf angesagt. Um 1800 vollzieht sich ein Wandel, in dem die Aufklärer ihr eigenes Programm der Erkenntnisgewinnung kritisch reflektieren. Gewonnen wird die Einsicht, dass alles Helle und Offenbare auf einer dunklen Basis aufruht, die die Grenzen menschlicher Welt- und Selbsterkenntnis markiert. Sie wird bis in die Gegenwart grundlegend für die künstlerische Verarbeitung von Nacht und Dunkelheit.0Mit Beiträgen von Dieter Blume, Johannes Grave, Britta Hochkirchen, Helmut Hühn, Verena Krieger, Thomas Lange, Max Pommer, Alexander Rosenbaum, Sabine Schneider, Christian Scholl, Tilman Schreiber, Silke Silkeborg, Harald Tausch, Jan Urbich.