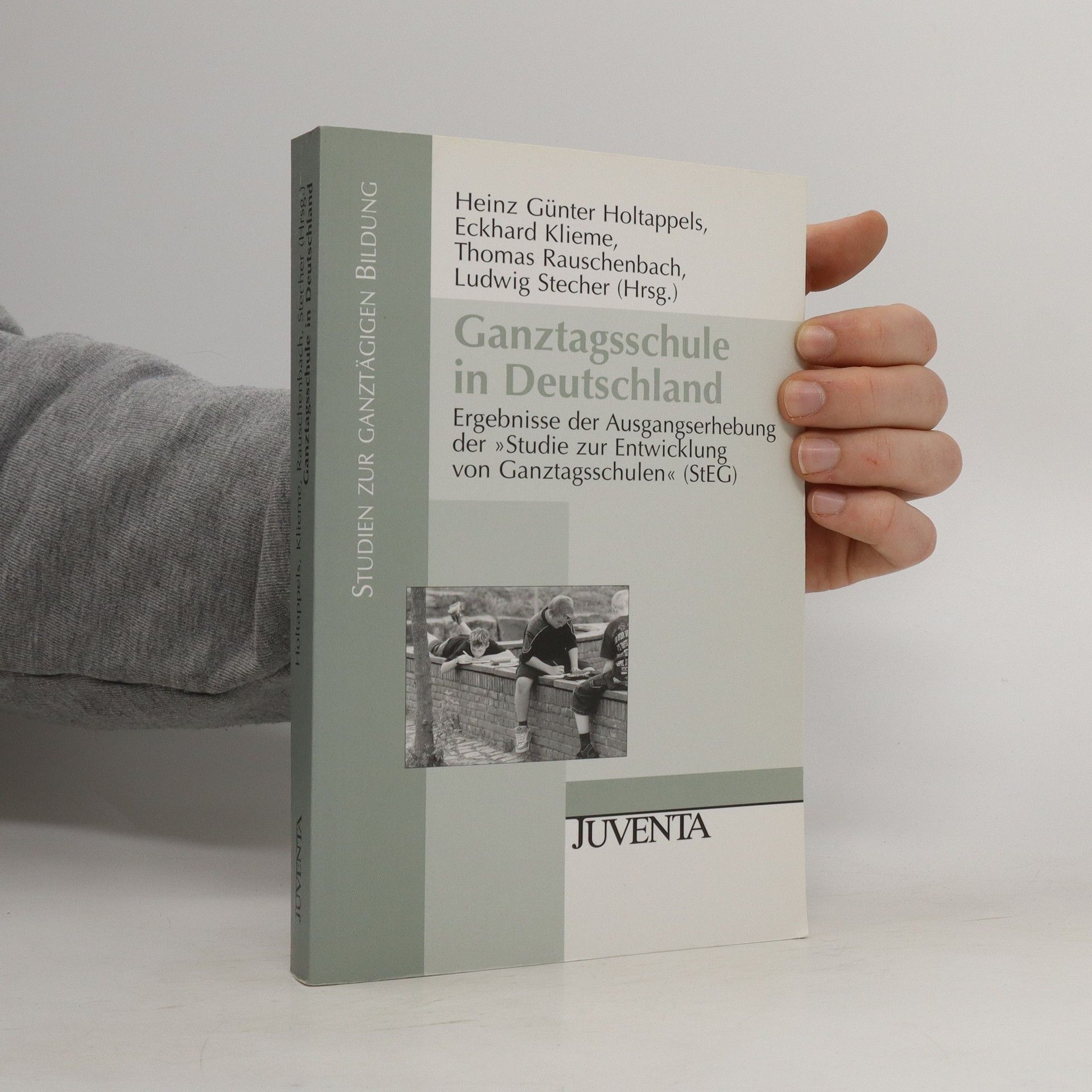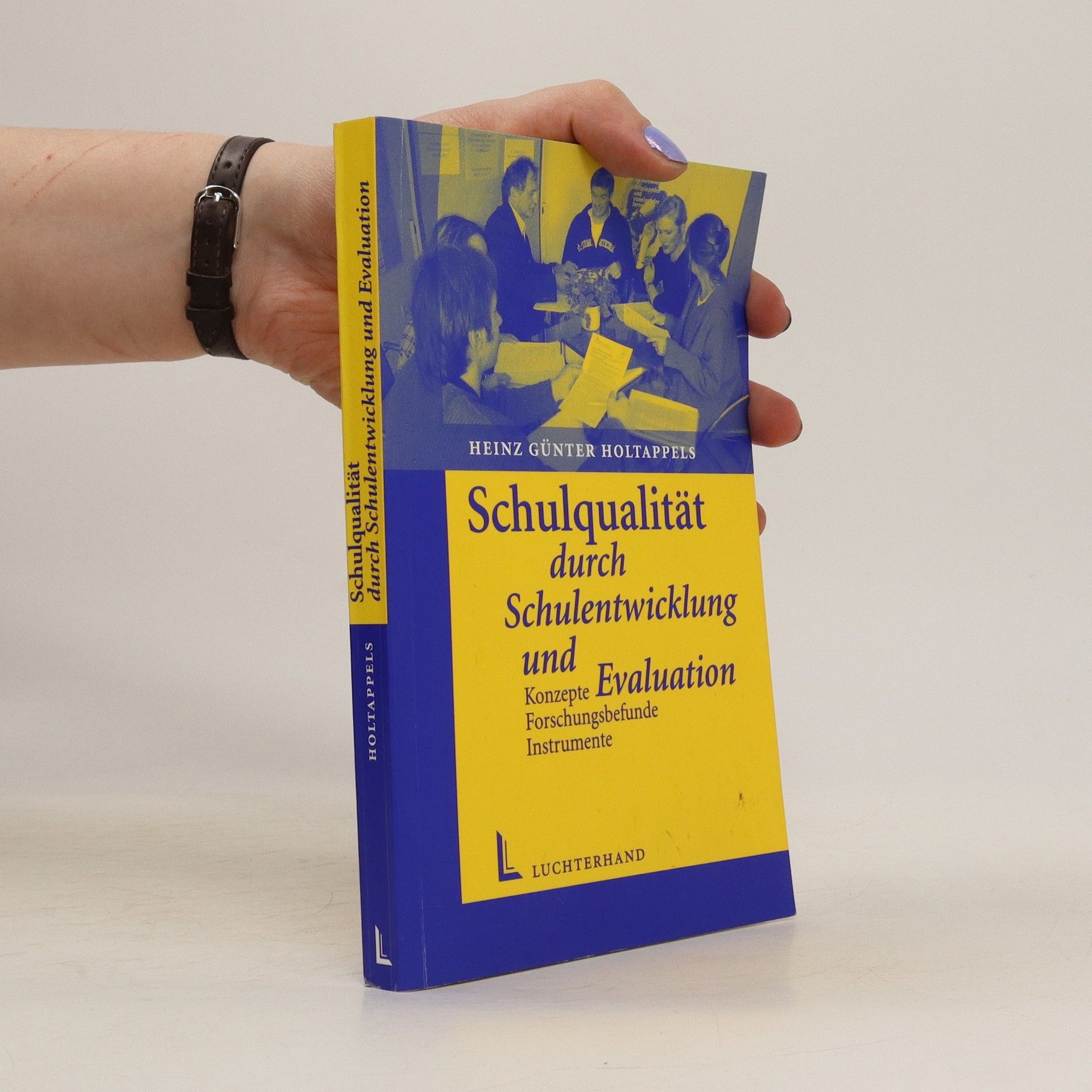Jahrbuch der Schulentwicklung. Band 21
Kooperation und Professionalisierung in Schulentwicklung und Unterricht
Das Jahrbuch der Schulentwicklung setzt dieses Mal den inhaltlichen Schwerpunkt auf das Themenfeld »Kooperation in Schulen und Professionalisierung von Lehrkräften im Rahmen von Schulentwicklung und Unterricht«. Die neun Beiträge befassen sich mit Theorieansätzen und Studien zu Forschungsfragen, die einerseits den Arbeitsplatz, die Zusammenarbeit und die Kompetenzen von Lehrerinnen und Lehrern betreffen, andererseits zentrale Problemstellungen für die Entwicklung von Schulen und ihrer Lernkultur aufgreifen. Dazu gehören sowohl Wirkungen der Kooperation auf den Unterricht im Kontext von Heterogenität und professionellem Handeln als auch Analysen zu Entwicklungsverläufen und der pädagogischen Arbeit von Lehrkräften an Schulen in schwierigen Lagen.