Bertolt Brecht, Leben des Galilei
Inhalt, Hintergrund, Interpretation ; mit Info-Klappe

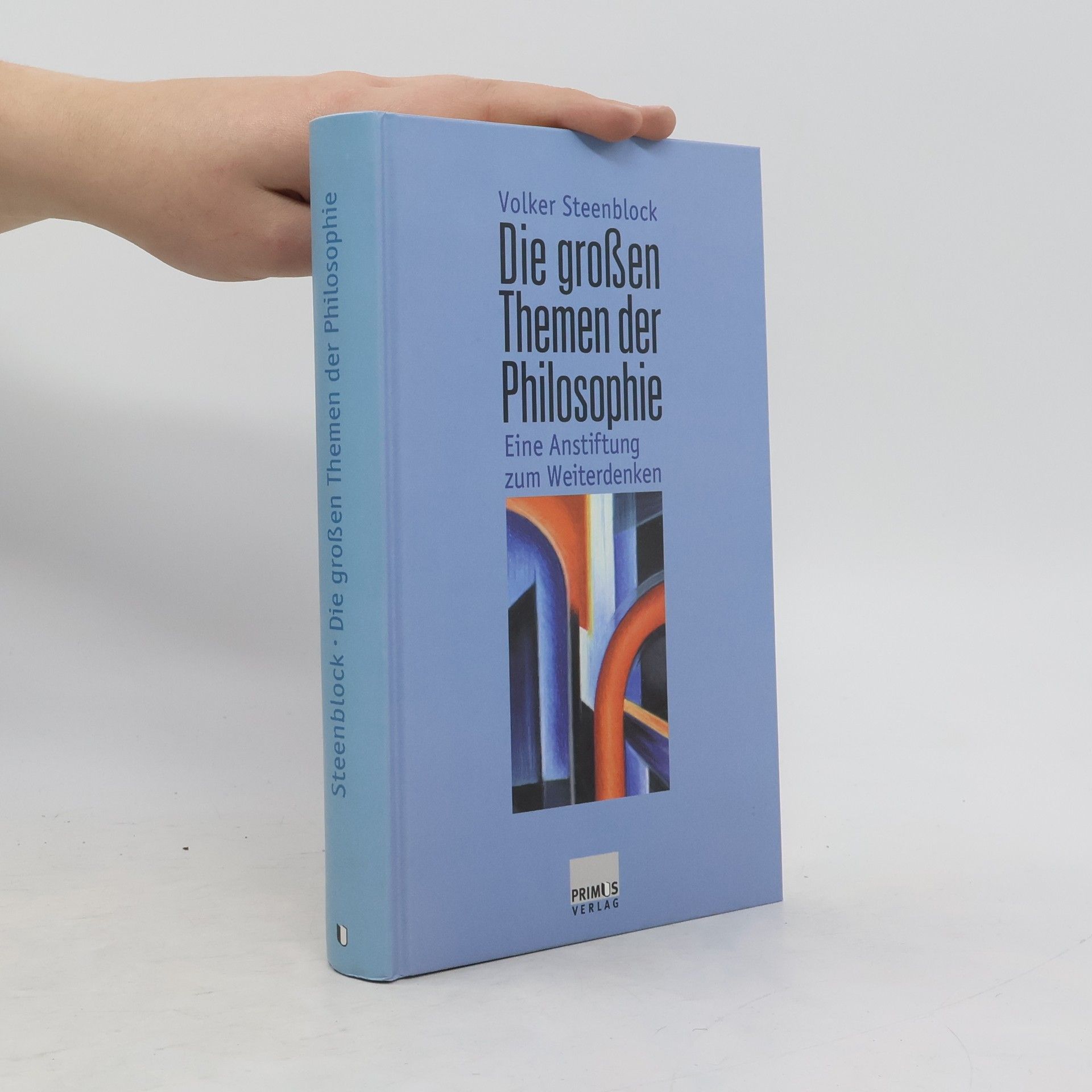

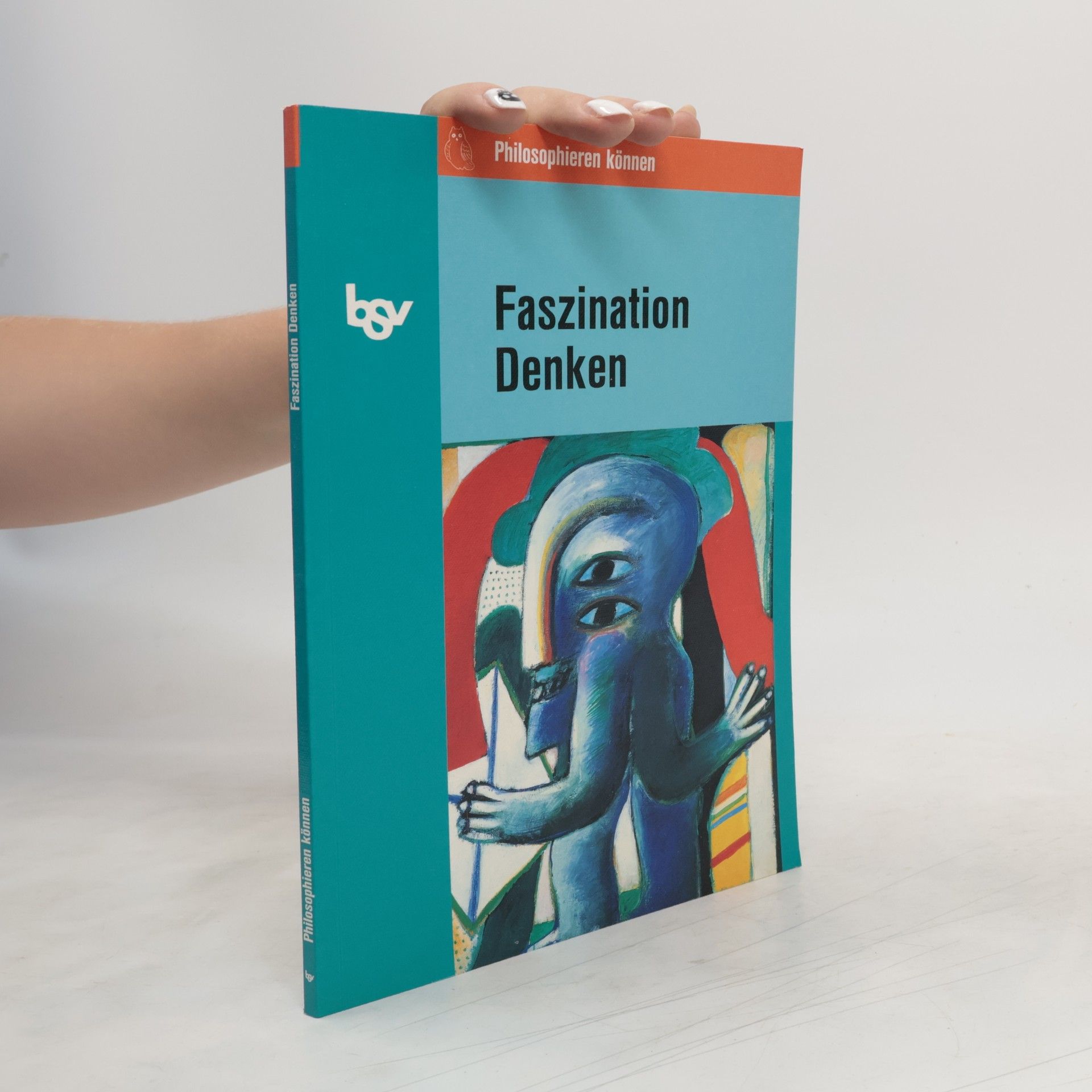
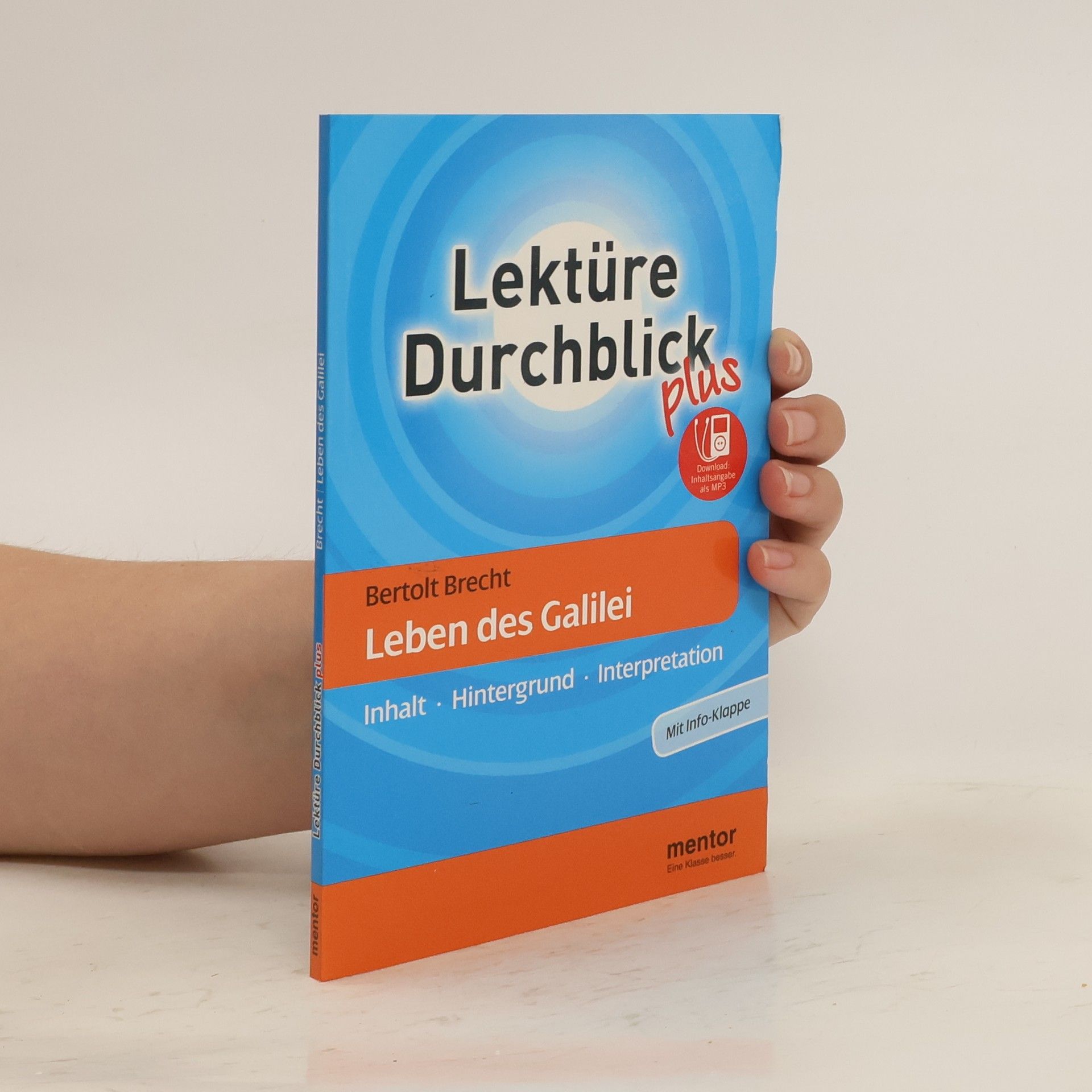
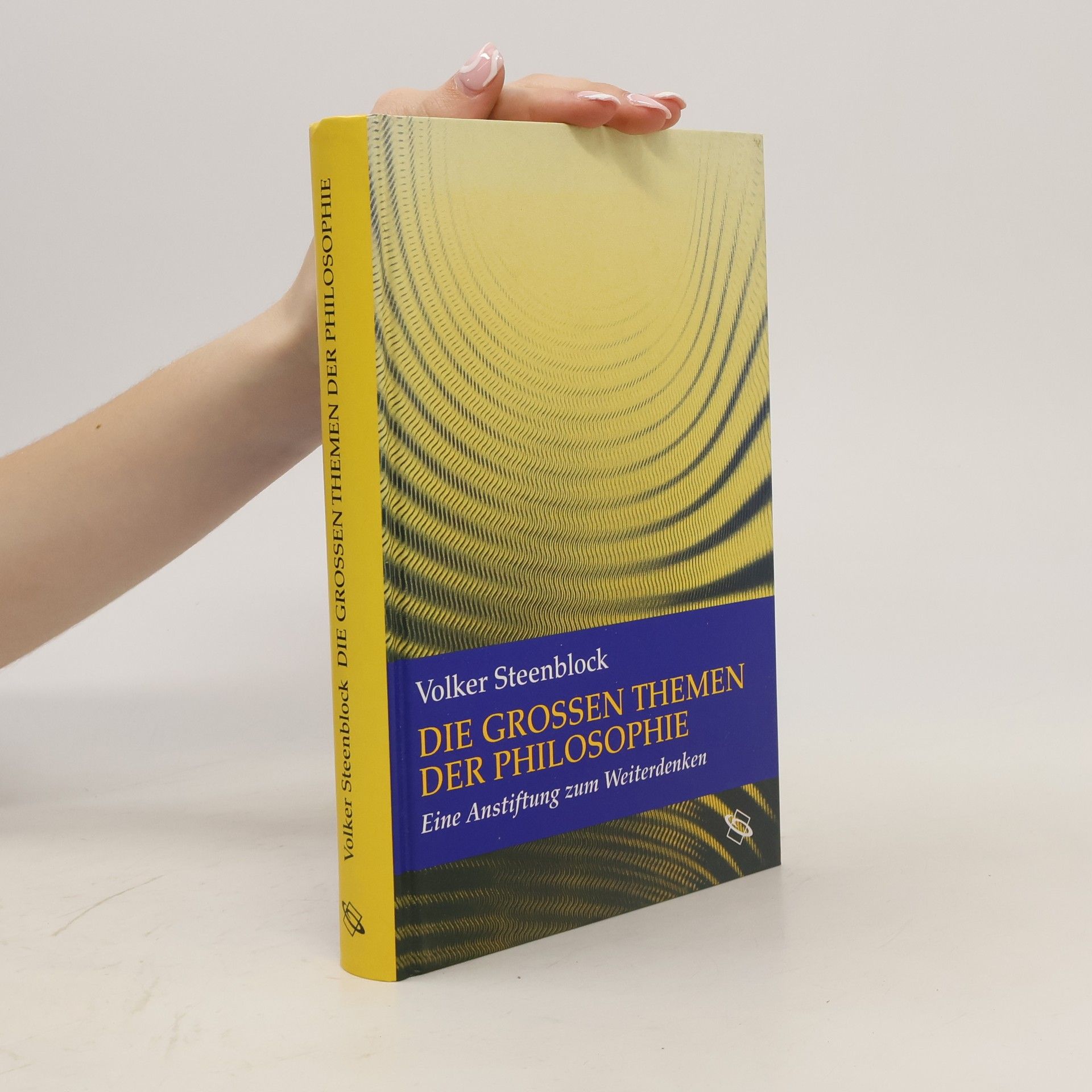
Inhalt, Hintergrund, Interpretation ; mit Info-Klappe
Ein Durchgang durch zweieinhalb Jahrtausende Philosophieren in etwa 100 Text-Ausschnitten, die jeweils durch einen kurzen Abschnitt zu Biographie und Werk des Autors eingeleitet werden - von den Vorsokratikern bis heute.
Wer möchte nicht einmal mit Sokrates über den Marktplatz wandeln oder Platon als Politikberater erleben? Wen interessiert nicht, warum die ionischen Naturphilosophen einmal Feuer und dann Wasser als Grundstoff des Lebens beschrieben oder weshalb die Kyniker oft nackt durch die Stadt rannten? Die Philosophie der Antike ist voller bunter Szenen und seltsamer Persönlichkeiten, die in diesem philosophiehistorischen Panorama Gestalt annehmen. Volker Steenblock führt in die Grundmotive des antiken Denkens ein, erklärt die Personen und Themen und ermöglicht es jedem, sich eine eigene Meinung über Sokrates & Co zu bilden. Denn natürlich waren auch die alten Philosophen einfach nur Menschen, fasziniert von der Schönheit der Welt und neugierig auf ihre Geheimnisse. Dieser Neugier und der philosophischen Lebens- und Verstehenslust nachzuspüren, das ist das Ziel dieses Buches. Biographische Informationen ergänzen sich dabei mit Erläuterungen der Kerntexte und Beschreibungen ihrer Auswirkungen auf die Geschichte des Denkens.
Anschaulich, kompakt und klar: der perfekte Durchblick für die Deutsch-Lektüre! Präzise Inhaltsangabe, verständliche Hintergrundinformationen und Interpretation, Aufgaben mit Lösungstipps. Extras: Schaubilder zu Personen und Aufbau, Stichwortverzeichnis, praktische Infoklappe.
Eine Anstiftung zum Weiterdenken
Volker Steenblock legt hier eine didaktisch gut aufbereitete Einführung in die großen Themen der Philosophie vor. Jedes Kapitel führt informativ ins Thema ein, gibt Kostproben von wichtigen Texten aus der Philosophiegeschichte, enthält Anregungen zur eigenen Vertiefung und gibt wertvolle weiterführende Hinweise.
Informationen zum Titel: Wie werde ich glücklich? Woher kommt das Leid? Was ist richtig? Was haben andere Menschen dazu gedacht, gesagt, geschrieben? Verschiedene methodische Zugriffe öffnen den Blick und machen Philosophiegeschichte für die Schüler/innen erfahrbar. Informationen zur Reihe: Die Themen von Philosophieren können gehören zu den zentralen Stoffen des Philosophie- und Ethikunterrichts. Der dreifache Zugriff (Bildpräsentation, Verknüpfung mit der Erlebniswelt der Schüler/innen und deren Fragehorizont, Einübung methodischer Kompetenz) verbindet Vertrautes mit einer motivierenden Präsentationsform. schovat popis