Gerhart Baumann Poradie kníh (chronologicky)
20. december 1920 – 25. august 2006
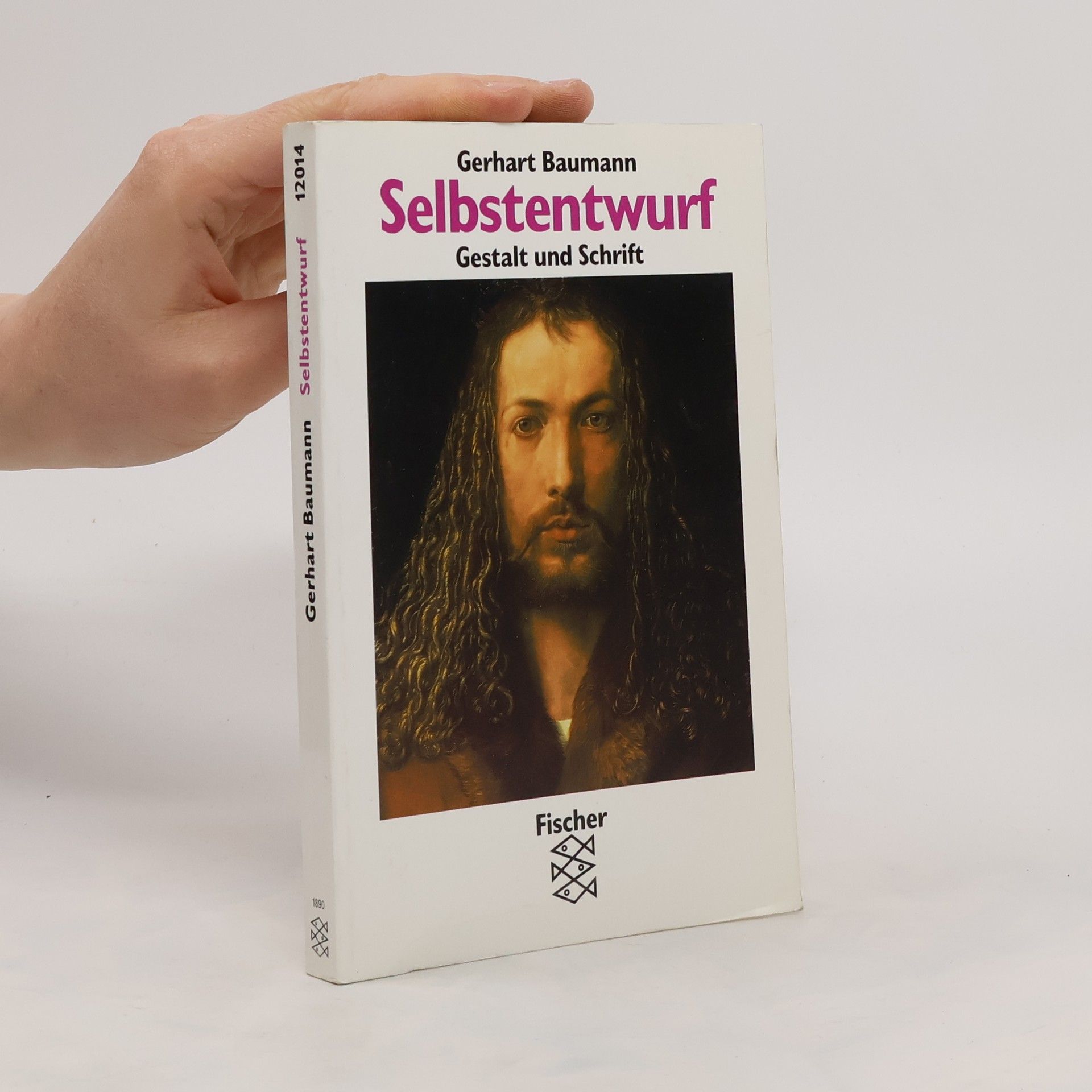
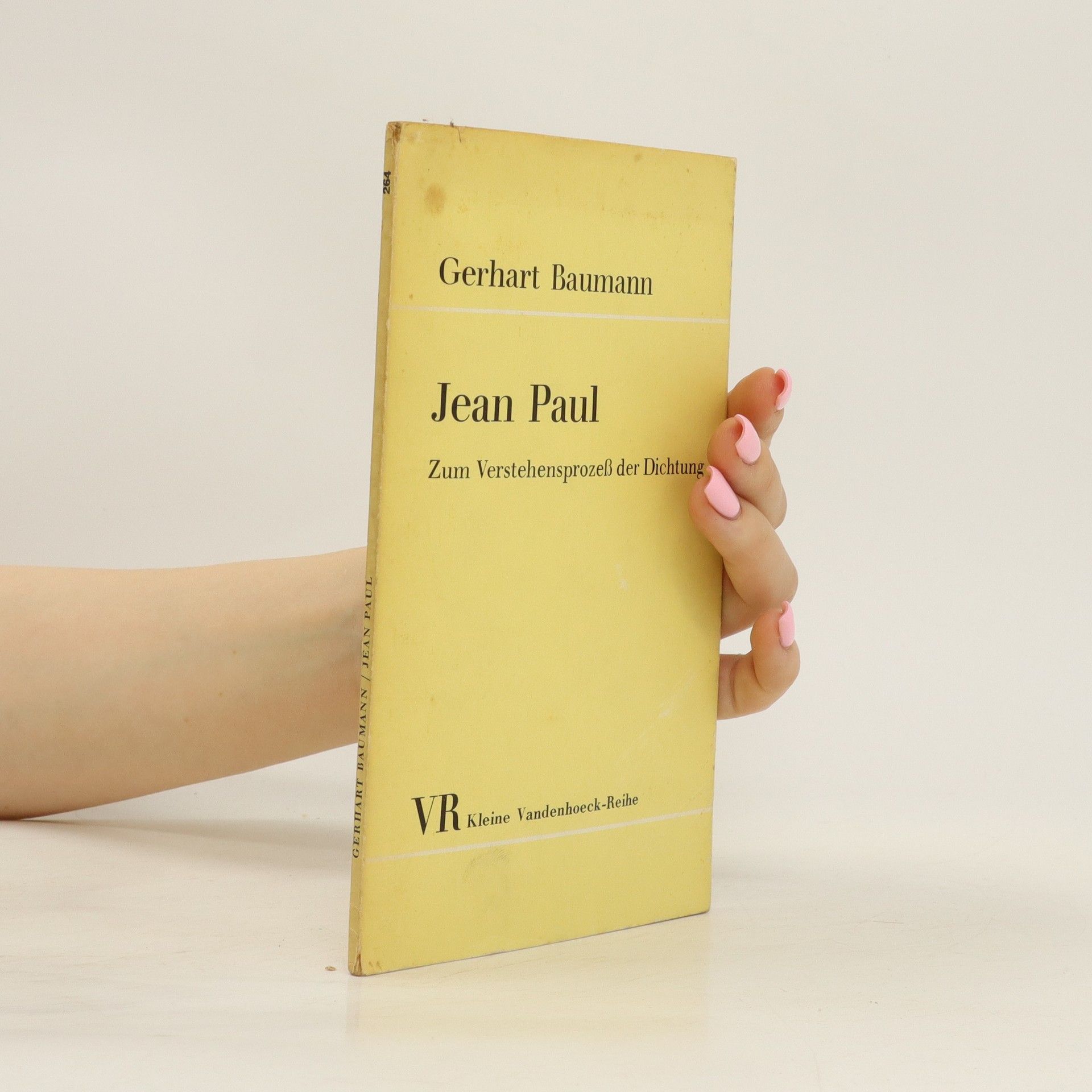
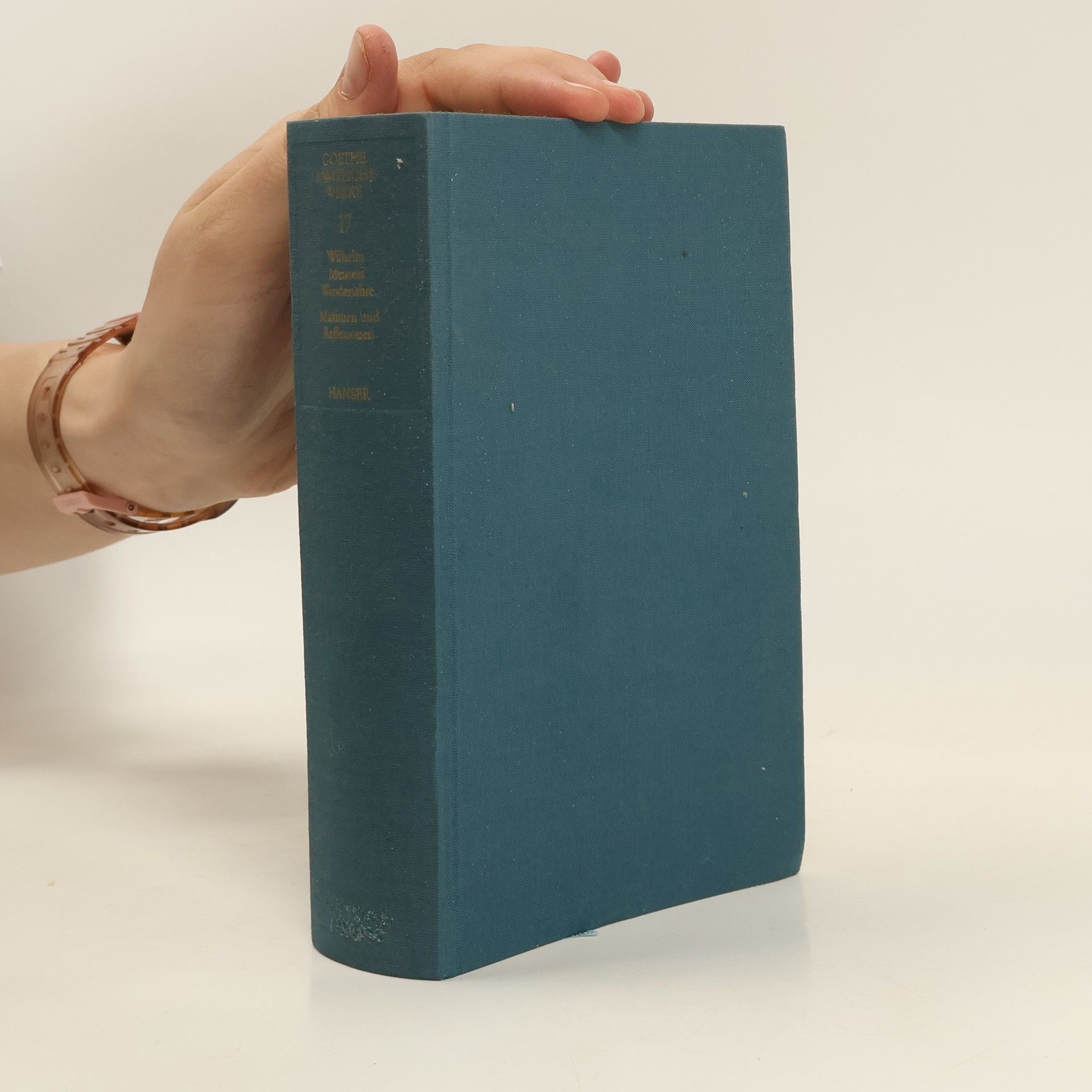


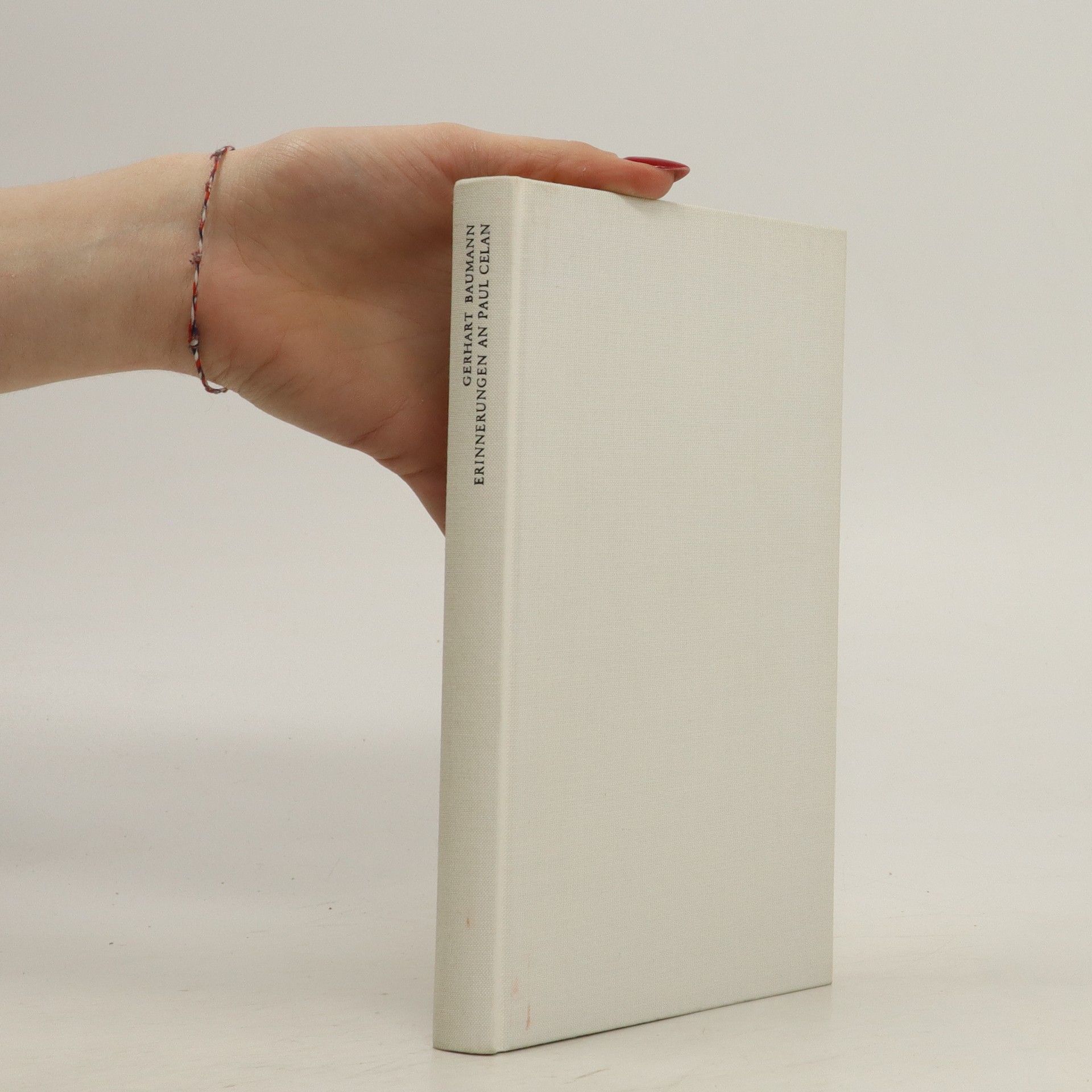
Wilhelm Meisters Lehrjahre. Maximen und Reflexionen
- 1349 stránok
- 48 hodin čítania
Robert Musil
- 234 stránok
- 9 hodin čítania
Neue Rundschau. Jg. 91, H. 2/3
- 330 stránok
- 12 hodin čítania
