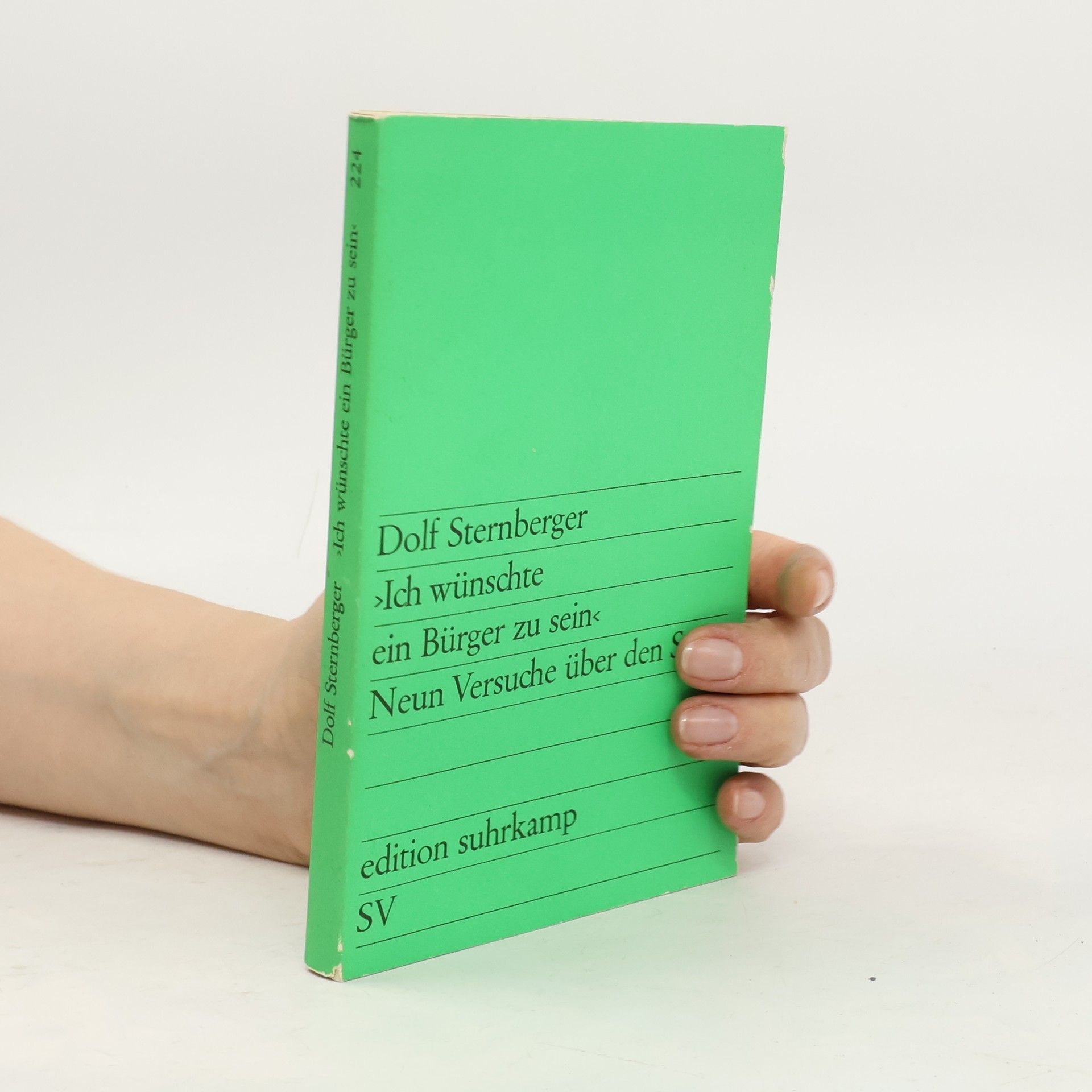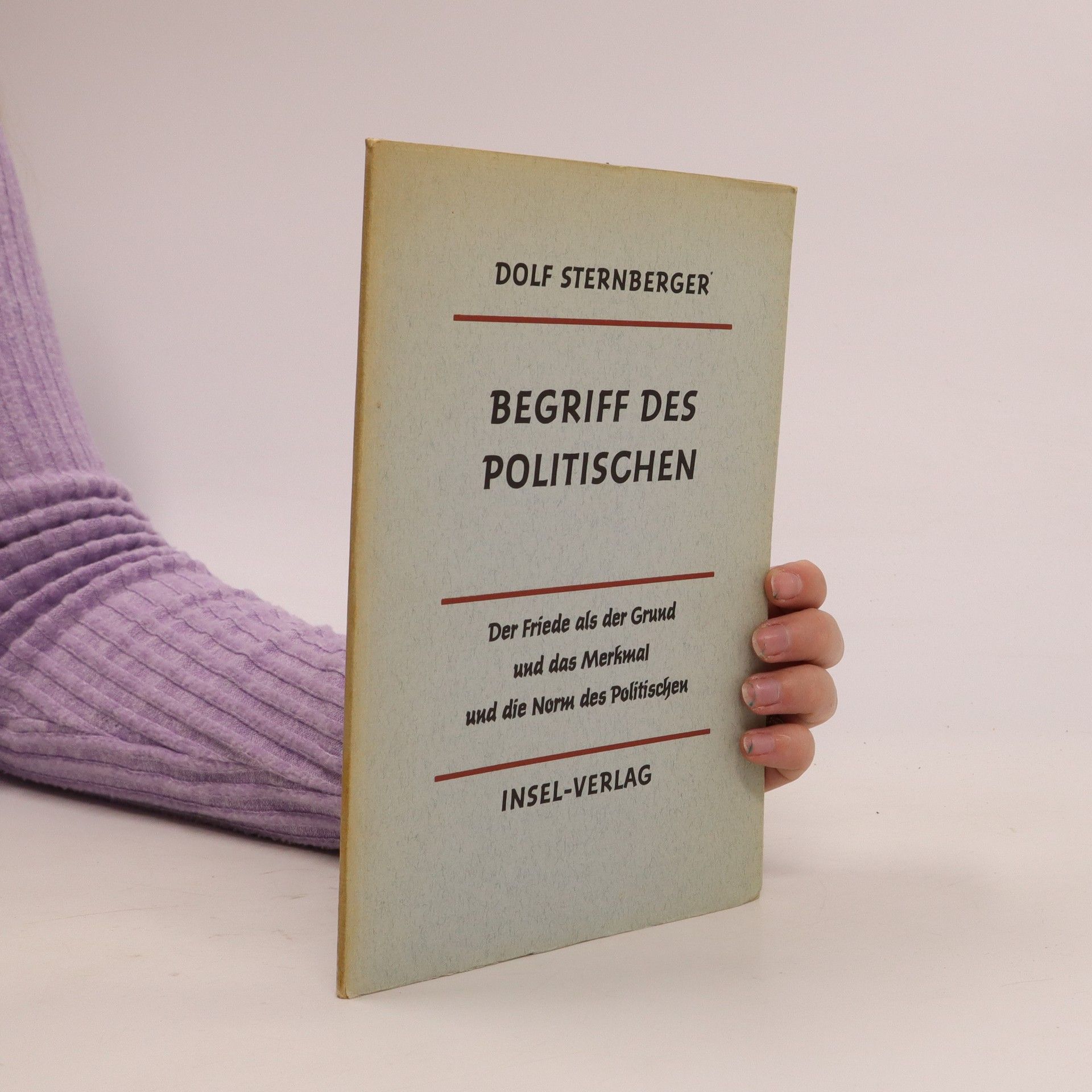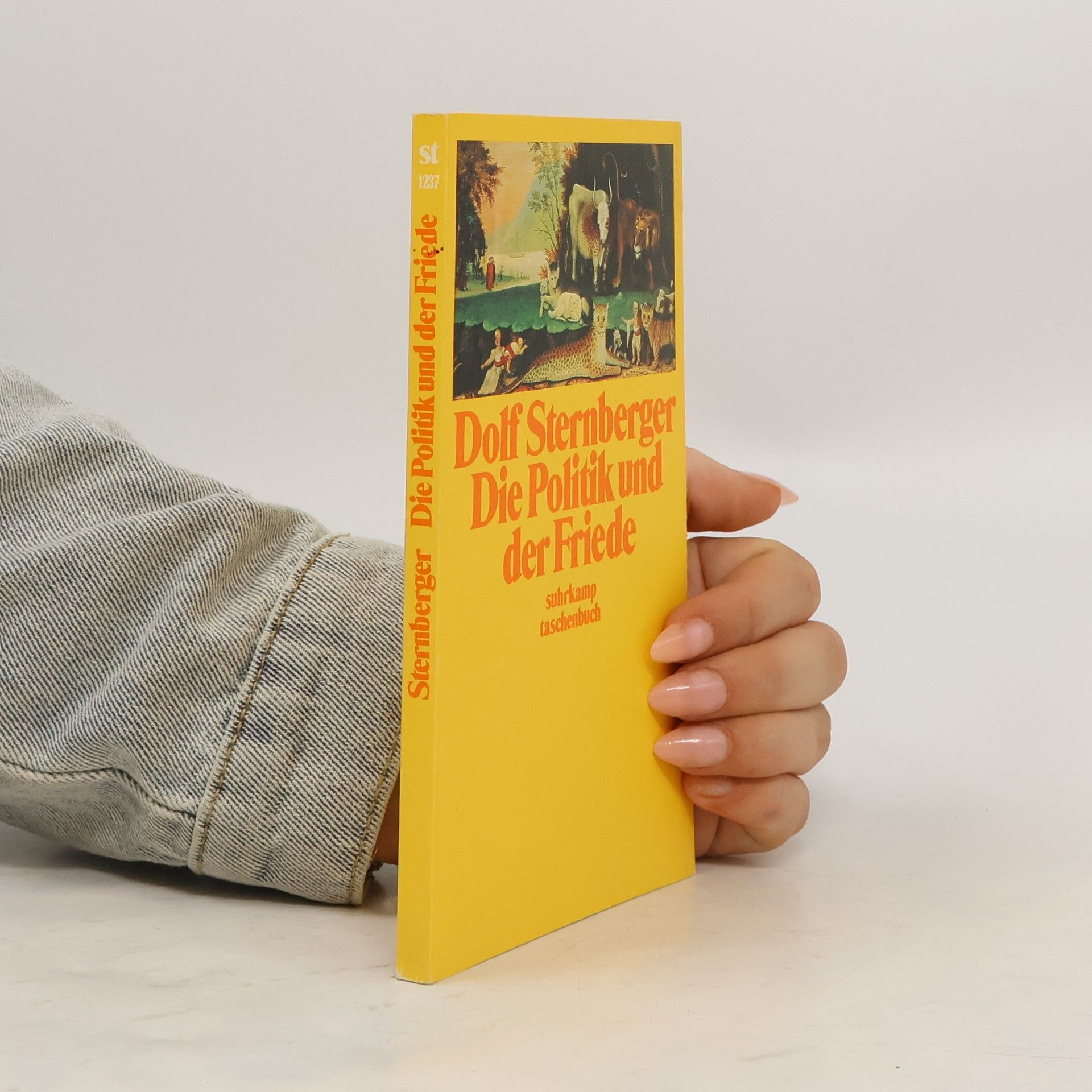Seit langem wird in der Sozialwissenschaft wie in der politischen Diskussion und Agitation der Begriff der Herrschaft unterschiedslos auf alle Arten politischer Ordnung angewendet. Daher ist "Herrschaftsfreiheit" zu einer utopistischen Losung derer geworden, die eine wahrhaft menschenwürdige Gesellschaft herbeiwünschen.Dolf Sternberger, einer der Begründer der Politischen Wissenschaft in Deutschland und mehrfach wegen seiner Essay-Kunst ausgezeichnet, hat seit langem der Herrschaft das andere Bildungsprinzip der Vereinbarung gegenüber- und an die Seite gestellt, und zwar nicht als Utopie, sondern als historisch und gegenwärtig wirkende Kraft. In diesem Band sind elf grundlegende Abhandlungen zu diesem Thema vereinigt.
Dolf Sternberger Knihy





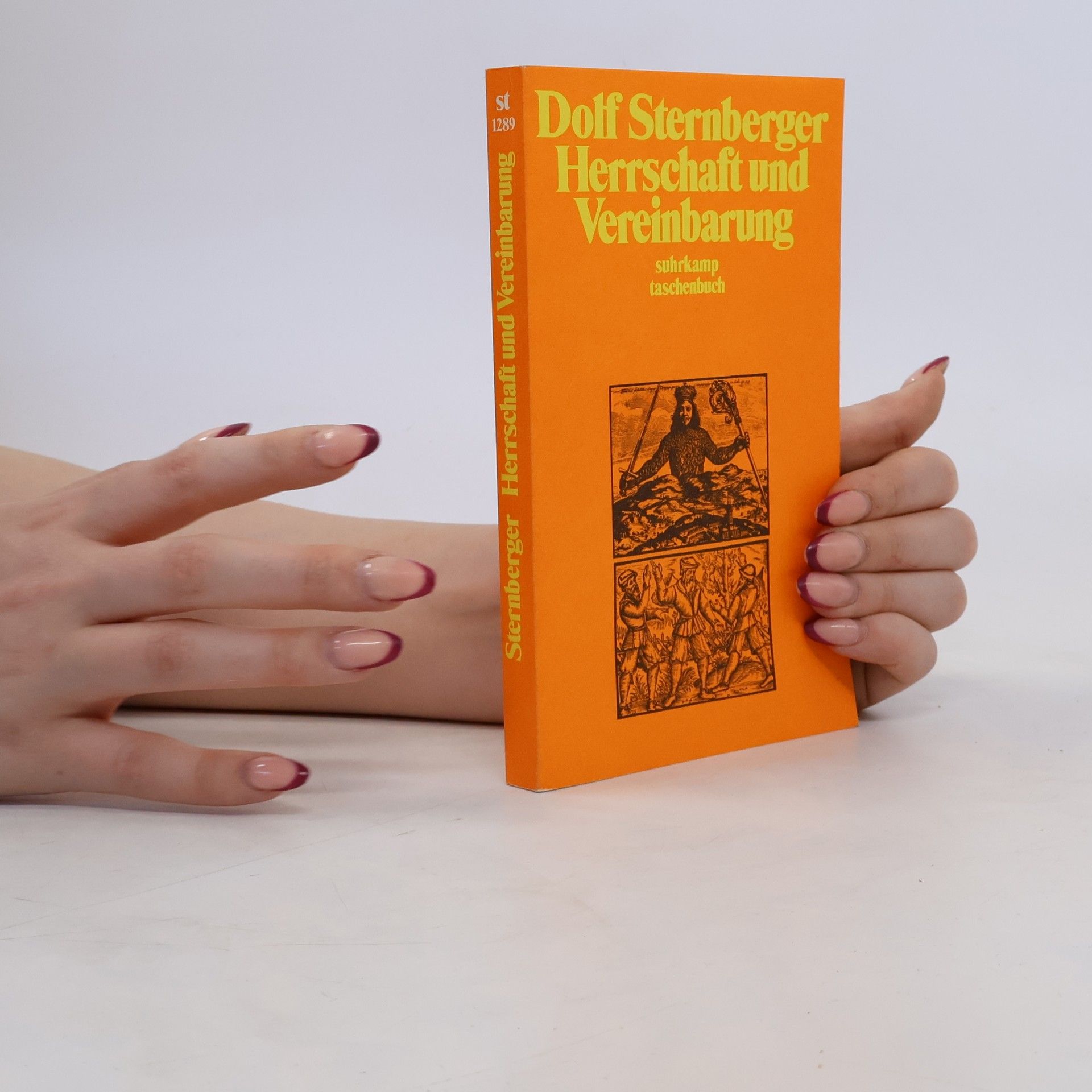
Schriften
- 366 stránok
- 13 hodin čítania
Die Politik und der Friede
- 131 stránok
- 5 hodin čítania
Geboren am 28. Juli 1907 in Wiesbaden, Studium der Philosophie, Germanistik und Kunstgeschichte in Kiel, Frankfurt am Main, Freiburg und Heidelberg, 1932 Promotion bei Paul Tillich. Von 1934 - 43 Redakteur der Frankfurter Zeitung , von 1945 - 1949 Herausgeber und Autor der Monatsschrift Die Wandlung, 1950 - 1958 Herausgeber der Zeitschrift Die Gegenwart . Von 1947 an Lehrauftrag an der Universität Heidelberg für politische Wissenschaft, ab 1962 bis zu seiner Emeritierung 1972 ordentlicher Professor für Politische Wissenschaft an der Universität Heidelberg. Dolf Sternberger gründete die Politische Vierteljahresschrift (PVS), die offizielle Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft , deren Vorsitzender er von 1961 bis 1963 war. Zahlreiche Auszeichnungen, darunter die Goethe-Medaille, der Literatur-Preis der Bayerischen Akademie der schonen Künste, der Ernst-Bloch-Preis. Gestorben am 27. Juli 1989 in Frankfurt am Main.