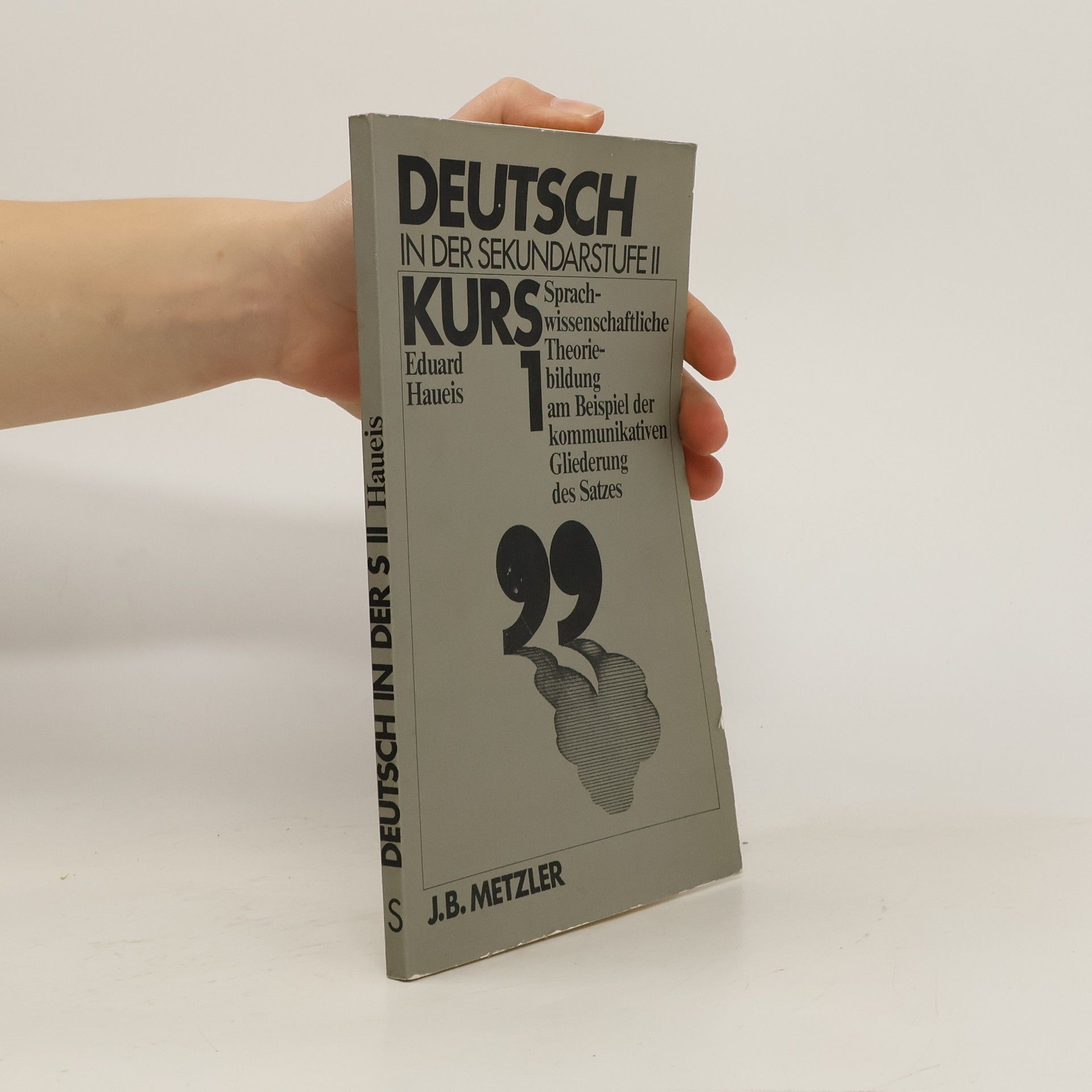Die sprechbare Schrift Zur Sprachlichkeit des literarischen Lernens im Deutschunterricht
- 284 stránok
- 10 hodin čítania
Ausgehend von dem ungeklärten Verhältnis zwischen Sprach- und Literaturdidaktik werden im ersten Teil die soziogenetischen Bedingungen für das Sprachlernen im Literaturunterricht untersucht. Im zweiten Teil wird eine Gesamttheorie für das sprachliche Lernen im Deutschunterricht entwickelt und im Hinblick auf den Literaturunterricht diskutiert. Die kulturelle und sprachliche Heterogenität unserer Gesellschaft erfordert ein Umdenken in der Deutschdidaktik. Es geht um die Frage, wie der Deutschunterricht allen Lernenden sprachliche Bildung ermöglicht. Die Antwort lautet: indem er sich als Sprachunterricht für alle versteht. Welche didaktischen Transformationen erforderlich sind, um diesem Anspruch zu genügen, und mit welchen Hindernissen dabei zu rechnen ist, klärt dieses Buch in einer zweiteiligen Untersuchung. Im ersten Teil geht es um die Bedingungen, unter denen literarische Textualität für das sprachliche Lernen genutzt werden kann, im zweiten Teil um eine didaktische Modellierung für das Sprachlernen beim Umgang mit literarischen Texten und im Deutschunterricht insgesamt. Inhaltsverzeichnis Schriftgesteuerter Ausbau von Sprachen - Die Soziogenese von 'Literatur' - Humboldts Sprachtheorie und das Konstrukt einer Bildungssprache - Die Sprachvergessenheit der Literaturdidaktik - vier didaktische Perspektiven: Sprachrichtigkeit, Sprachangemessenheit, Sprachwirksamkeit, Sprachmündigkeit