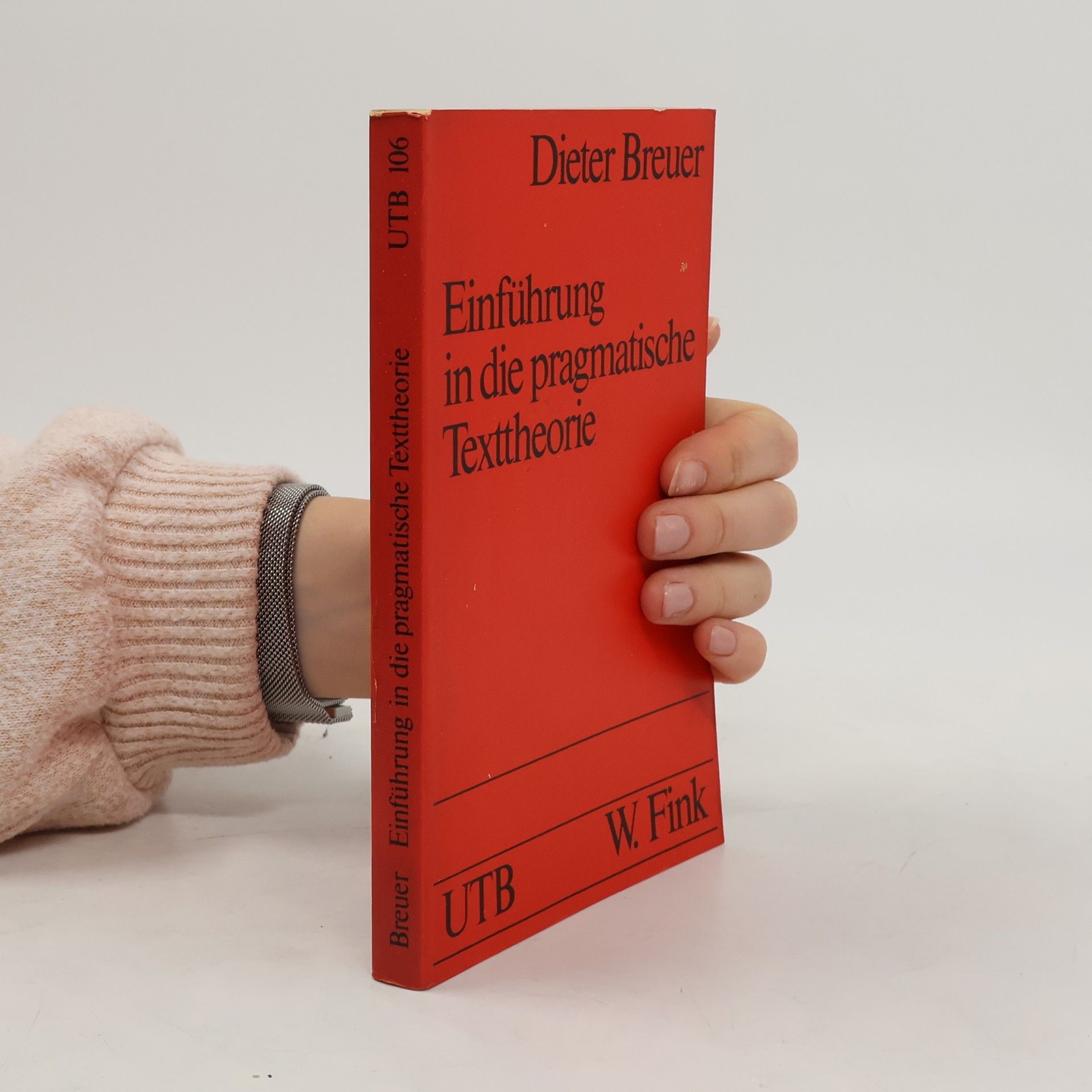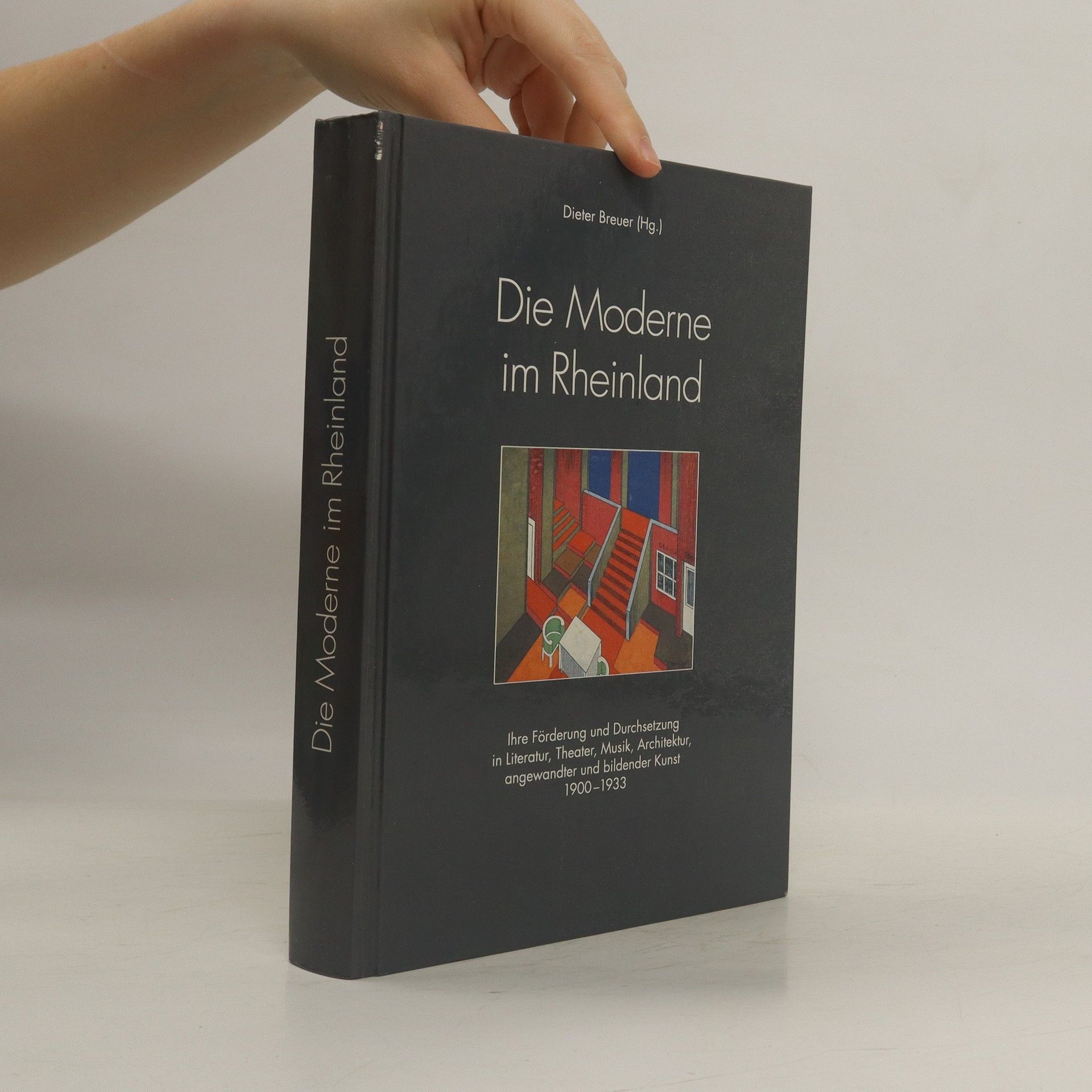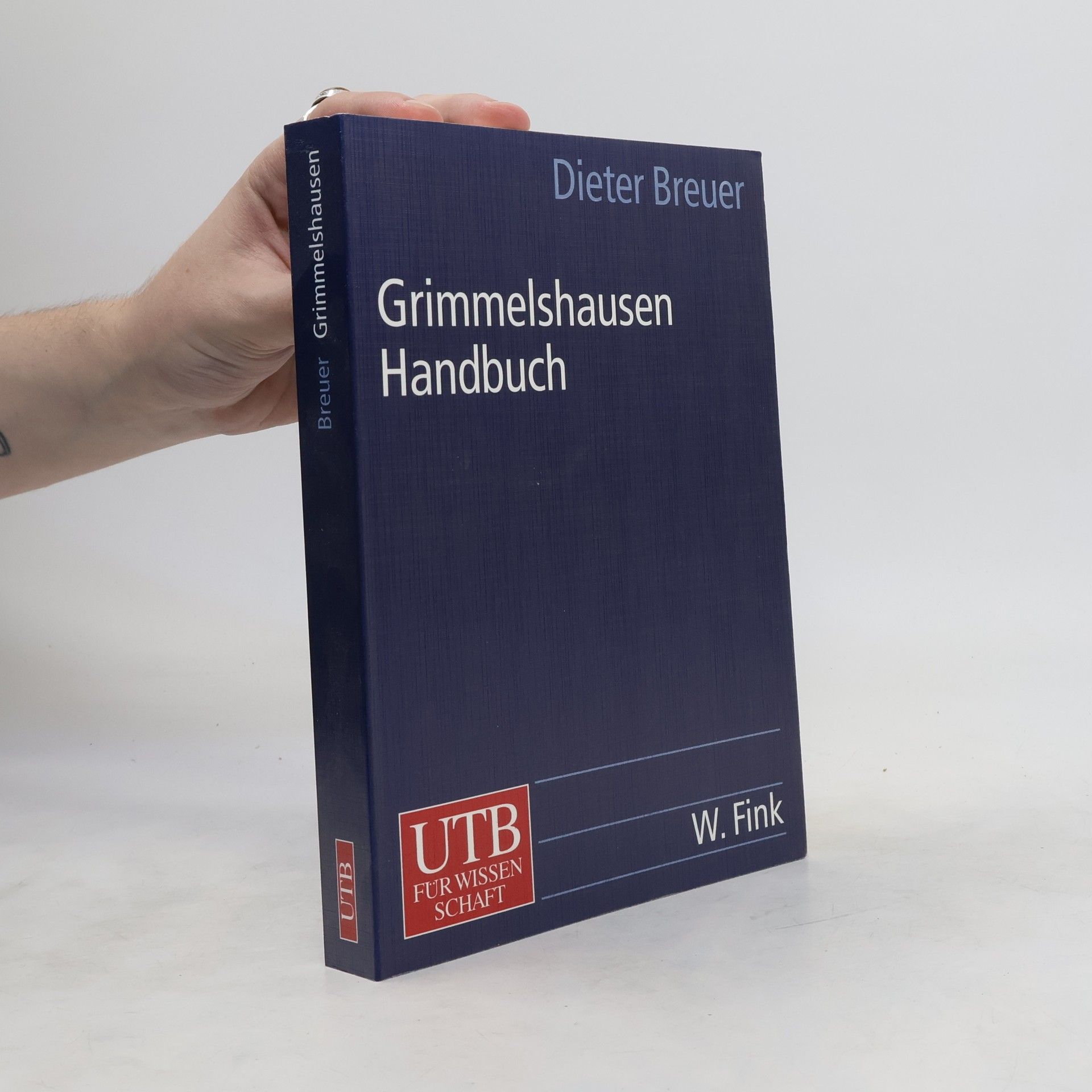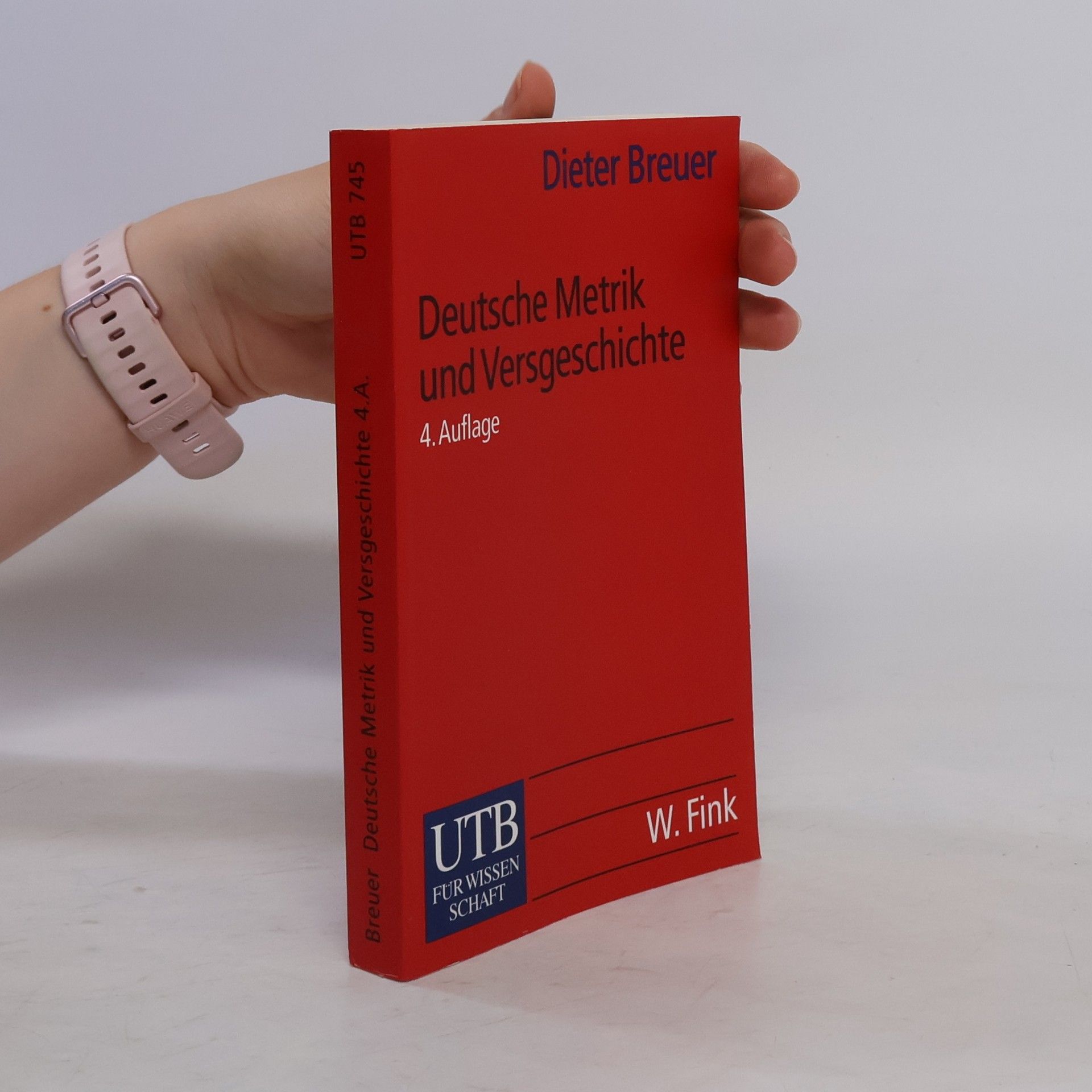Erzählen in einer lustigeren Manier
Zehn Studien zu Leben und Werk Grimmelshausens
Seit die romantisch-revolutionären Schriftsteller um 1800 und das damals neugegründete Universitätsfach Germanistik Grimmelshausen wiederentdeckten, von dem sie zunächst nicht einmal dessen wirklichen Namen, nur seine Pseudonyme kannten, haben ernstzunehmende deutschsprachige Schriftsteller, aber auch zahlreiche bildende Künstler dem simplicianischen Autor ihre Reverenz erwiesen. Gerühmt wird vor allem seine immer noch erstaunlich frische, saft- und kraftvolle, unverbrauchte, reiche Sprache. Hans Magnus Enzensberger vergleicht sie mit einer alten Münze, die unabgenutzt immer noch so glänzt, als wäre sie erst heute geprägt. Man könne kaum glauben, so schreibt er, dass sie „aufs Jahr genau so alt ist wie das Schloss von Versailles, so alt wie Racines Berenice und die Allonge-Perücke“. Man bewunderte aber auch Grimmelshausens Kunst der realistischen Darstellung, die Plastizität und Freiheit seiner Figuren, den ungezwungenen Umgang mit Stoffen und Formen der Tradition, seine diskrete, überkonfessionelle Christlichkeit. Die vorliegenden zehn Studien über die Dichtungen Grimmelshausens sind in jahrzehntelanger Beschäftigung mit diesem faszinierenden Autor entstanden. Sie erscheinen erneut in der Hoffnung, Neugier auf den großen Dichter der Barockzeit zu wecken, der ohne Scheu zugab, dass er nicht zu den Gelehrten gehöre und für Leser aller Stände und Schichten schreibe.