Wilhelm Voßkamp Knihy
27. máj 1936
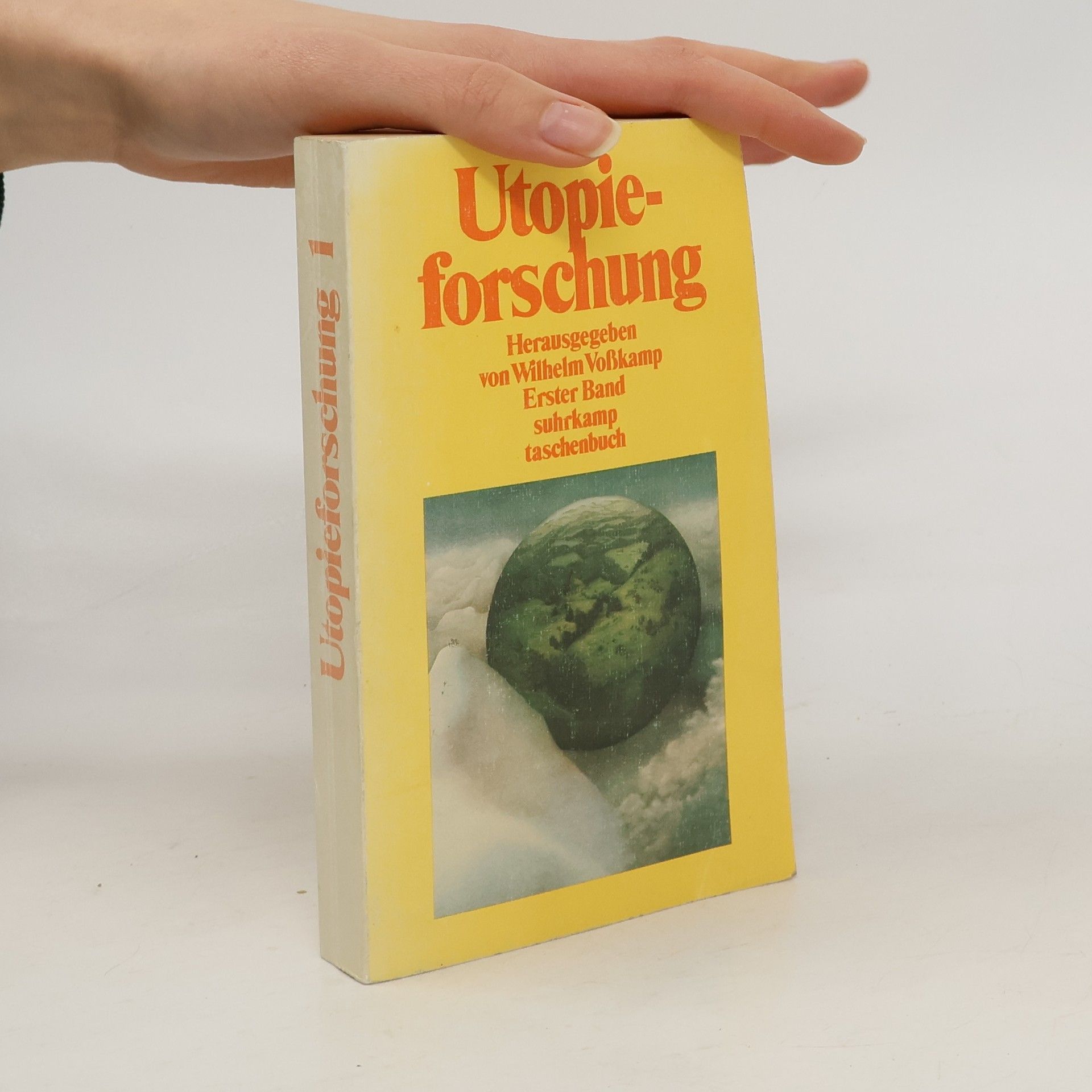
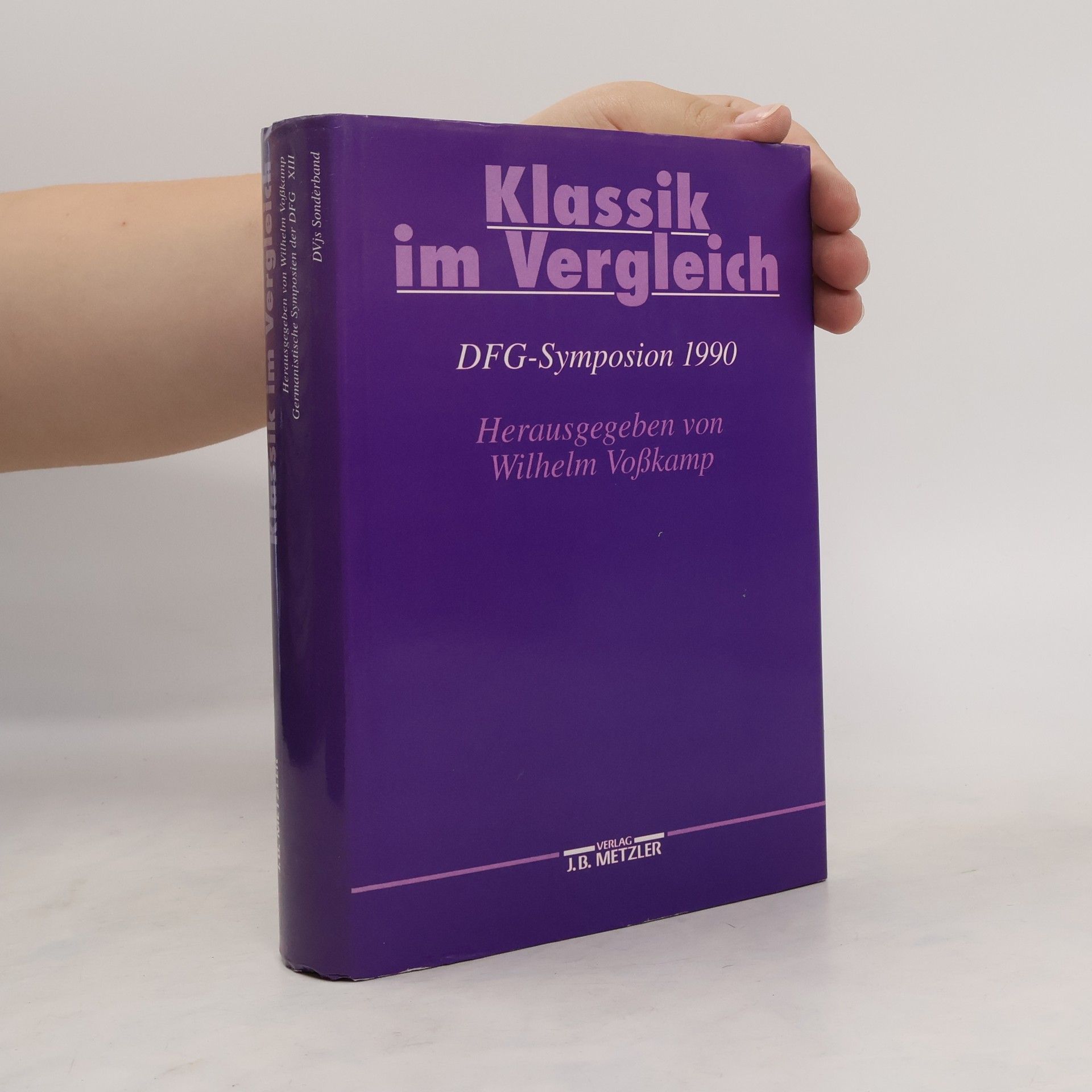

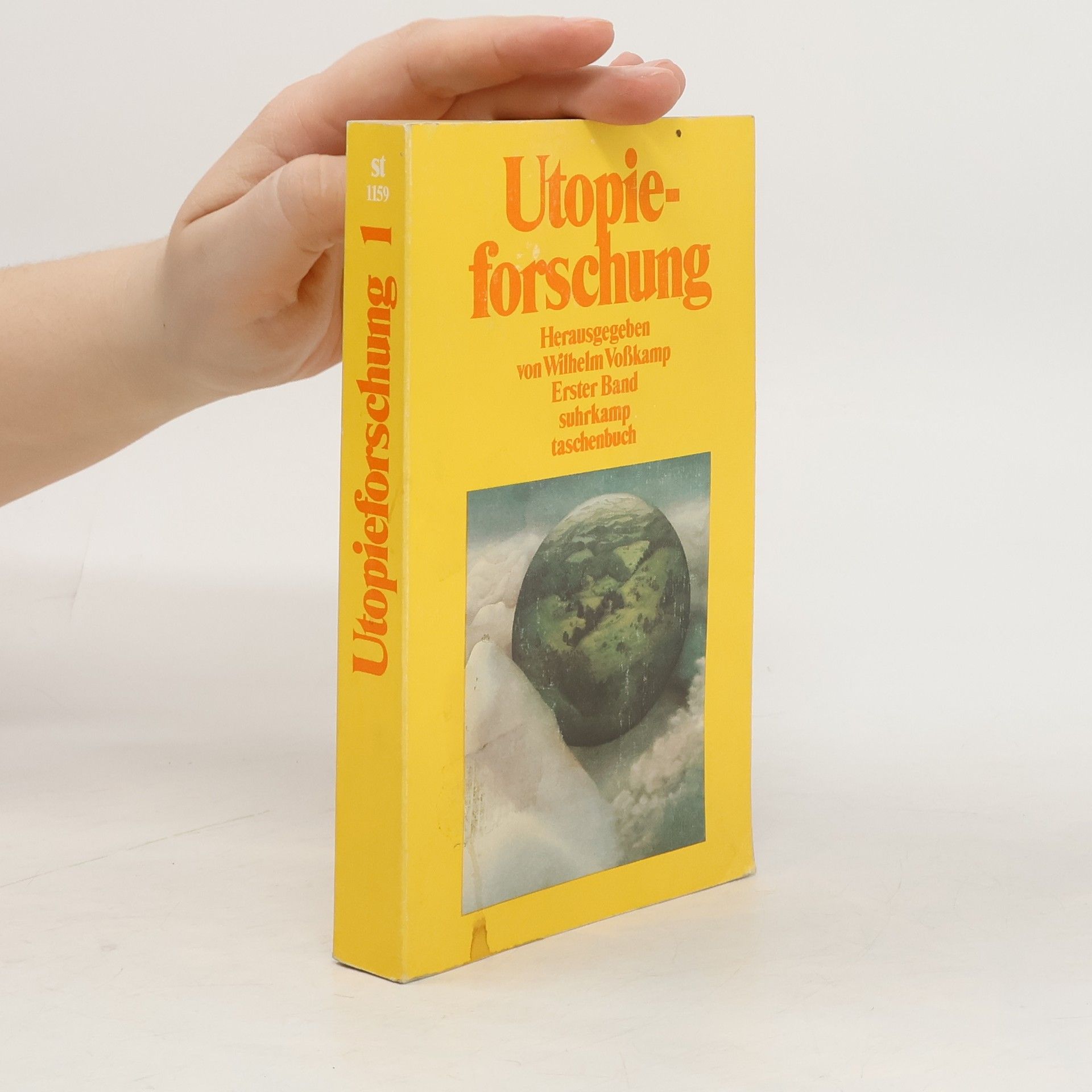
Klassik im Vergleich
DFG-Symposion 1990
Das Klassik-Problem muss stets in seiner Doppelheit von Normativität und Historizität gesehen werden. Erst im Spannungsverhältnis beider Aspekte entsteht der literaturwissenschaftliche Gegenstand Klassik, der in diesem Band anhand verschiedener europäischer Klassiken diskutiert wird.
Utopieforschung
Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichen Utopie