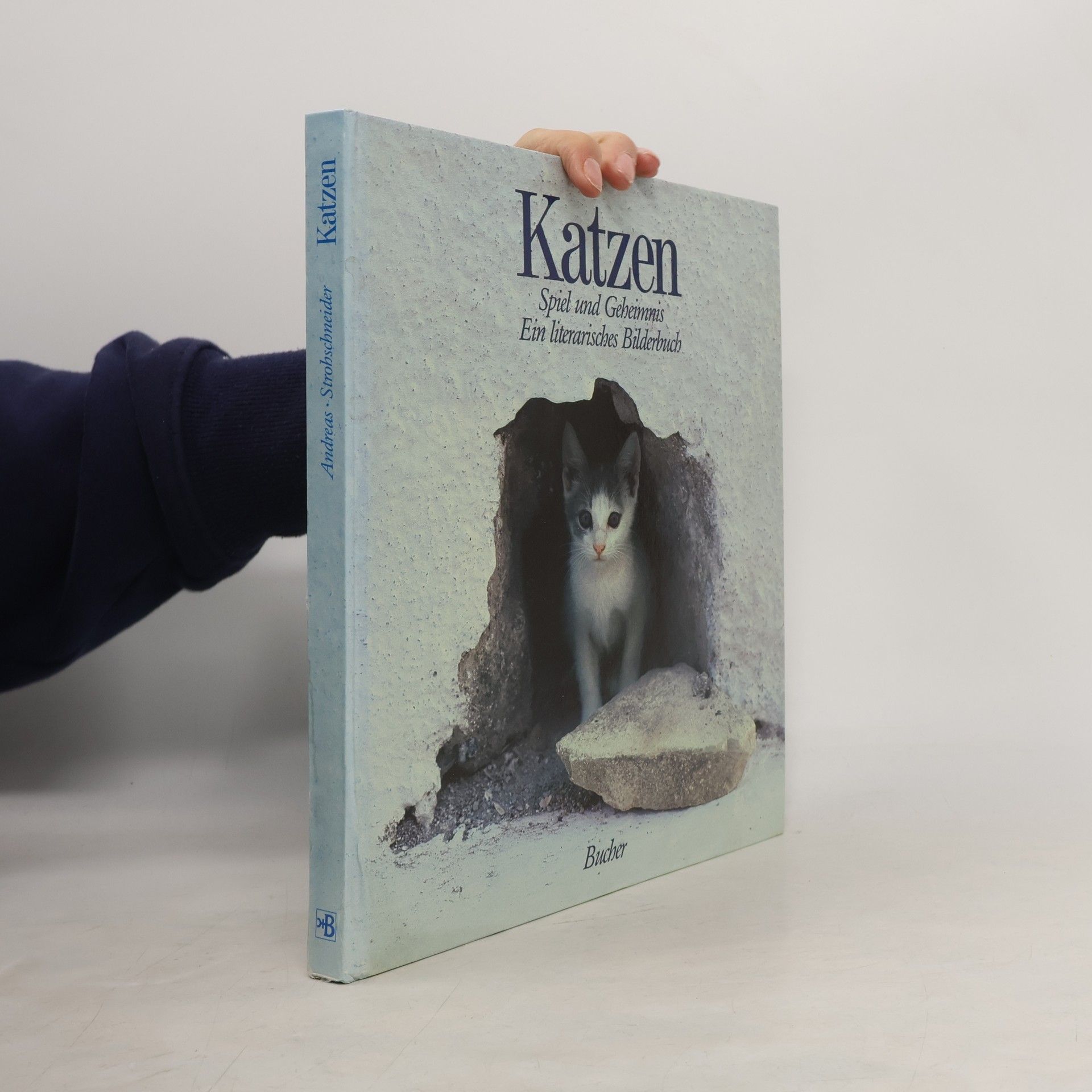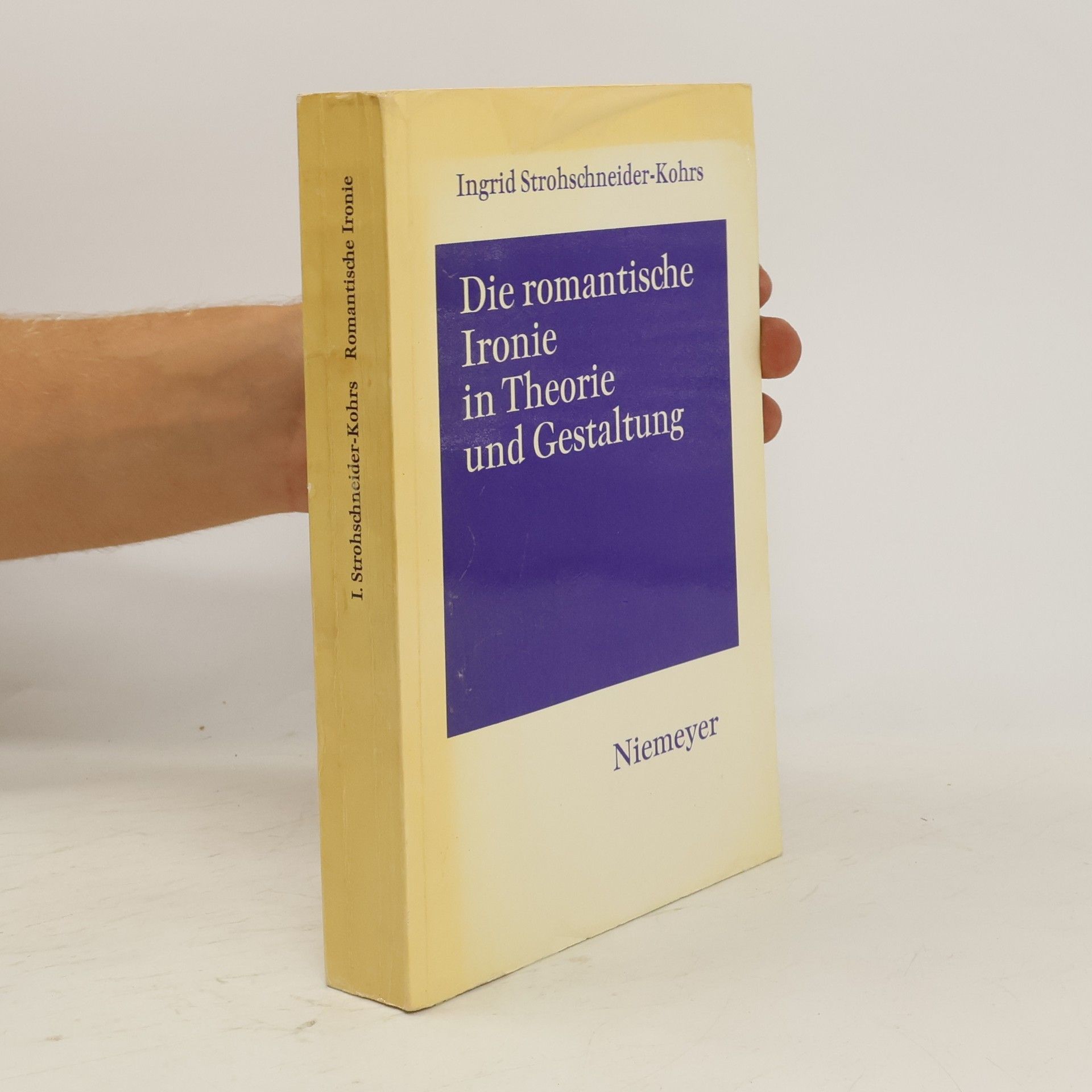In German. Das Thema dieser Untersuchung - als Studienausgabe unverändert nach der 2. Auflage von 1977 gedruckt - ist für die Romantikforschung ebenso von Interesse wie für kunsttheoretische Probleme der Moderne. Neben der Theorie der romantischen Ironie (von Friedrich Schlegel, Solger u. a.) werden Strukturzüge der Dichtung (von Novalis, Tieck und E.T.A. Hoffmann) aufgewiesen. In beiden Bereichen, auch in den Erscheinungsformen der Werke, zeigt sich eine Art von Reflexion als die Signalisation intellektuell-produktiver romantischer Kunst und damit als ein Prinzip von zeitübergreifender genereller Bedeutung -- Dieser Text bezieht sich auf eine andere Gebundene Ausgabe .
Ingrid Strohschneider Kohrs Knihy
26. august 1922 – 27. september 2014