Hitlers sozialer Wohnungsbau 1940-1945. Stadt Planung Geschichte 6
- 446 stránok
- 16 hodin čítania

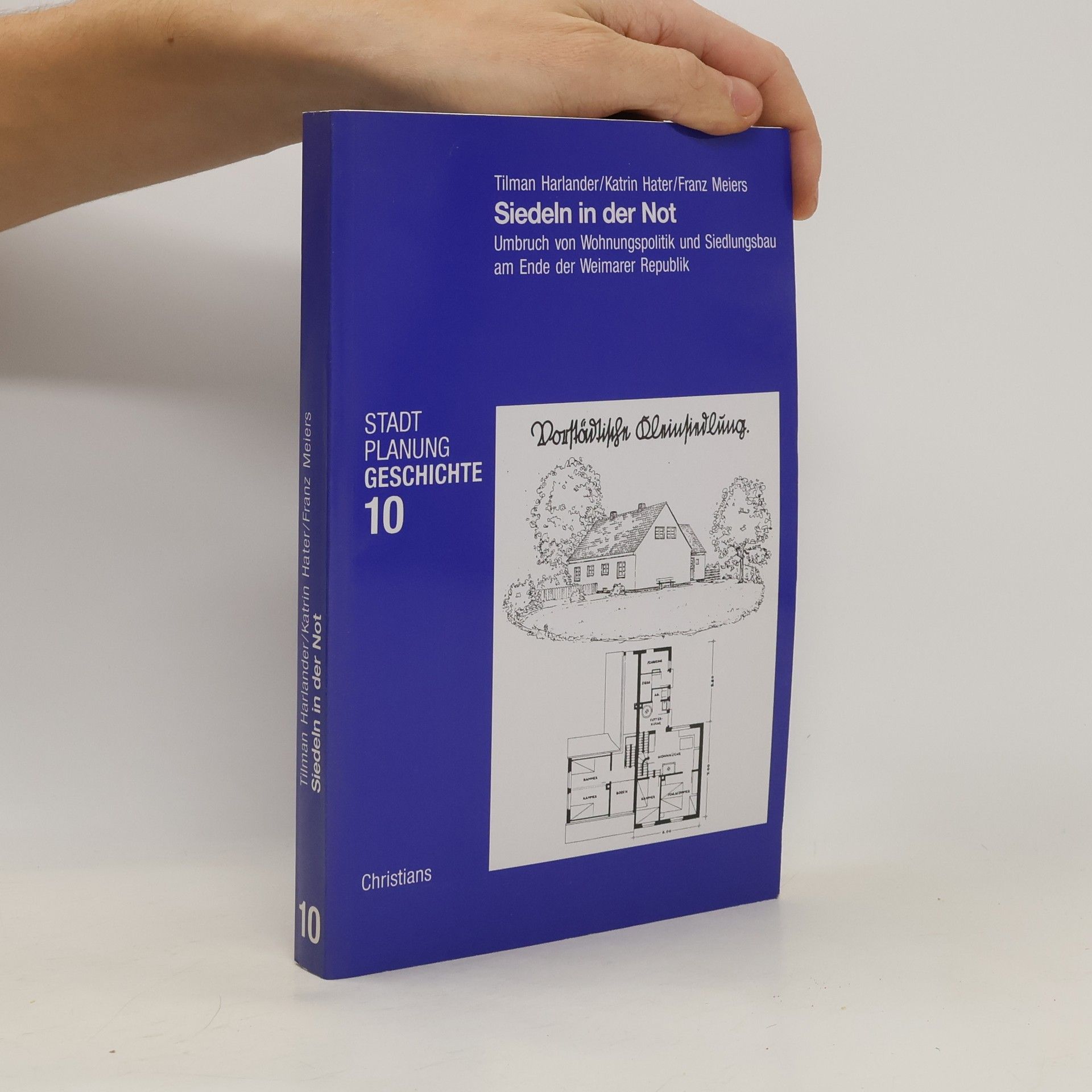
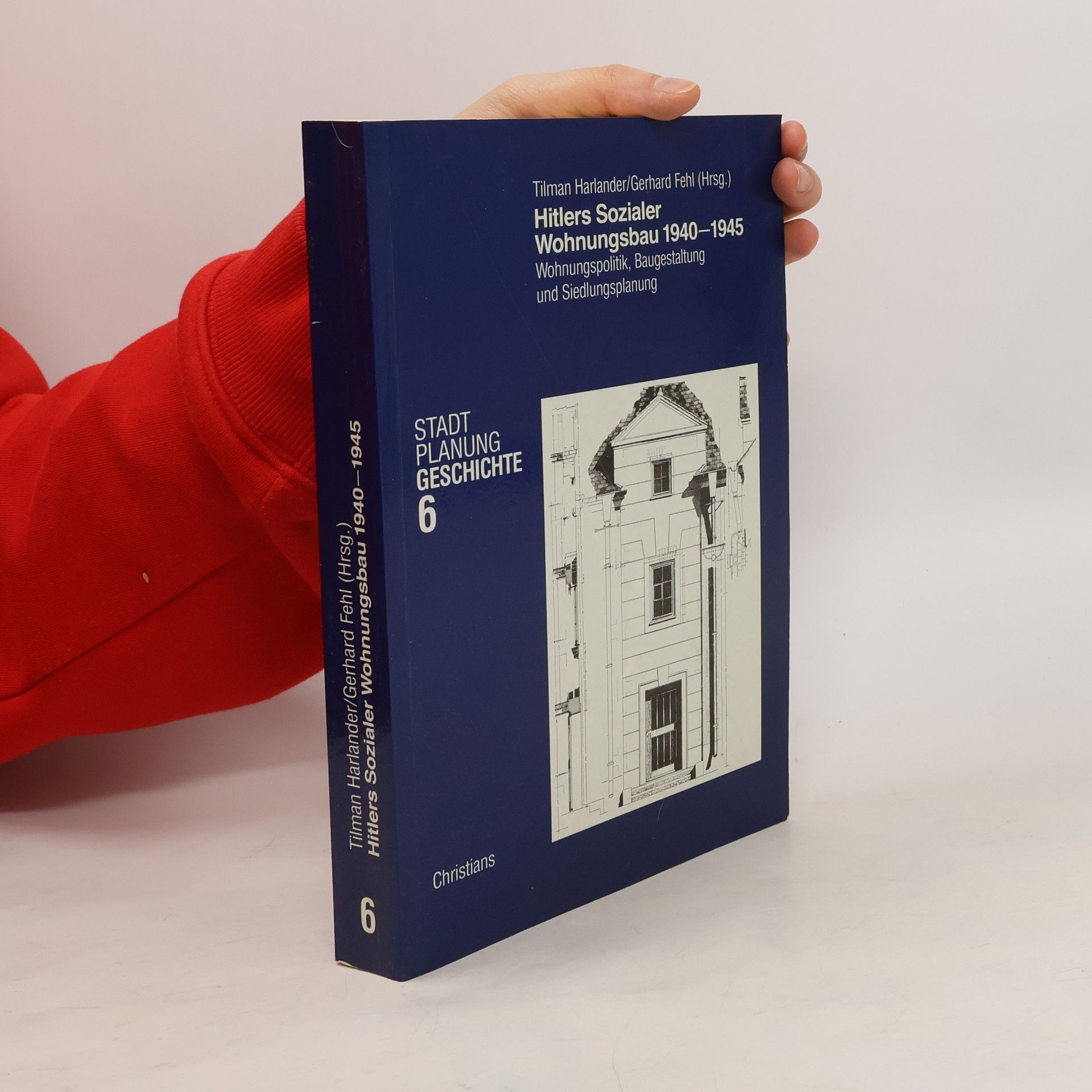
Für eine überwältigende Mehrheit der Deutschen ist das freistehende Eigenheim mit Garten nach wie vor der 'Wohnwunsch Nr. 1'. Suburbaner Städtebau wurde jedoch bislang in der deutschen Fachdiskussion weitgehend vernachlässigt, und so ist wenig bekannt, daß es in Deutschland eine reiche Tradition städtebaulich anspruchsvoller Formen des suburbanen Einfamilienhausbaus gibt. Der vorliegende Band hat die Stadtbaugeschichte von Villa und Eigenheim in Deutschland vor dem Hintergrund der verschiedenen Phasen der Suburbanisierung und im Kontext der jeweiligen staatlichen Wohnungspolitik zum Thema. Er führt in einem großen historischen Bogen von den ersten suburbanen Lust- und Sommerhäusern betuchter Stadtbürger des 17. und 18. Jahrhunderts über die Villenkolonien des 19. Jahrhunderts, die Gartenstädte, Kleinsiedlungen und Mustersiedlungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis zu den Versuchssiedlungen, Wohnparks, Eigenheimgebieten, Ökosiedlungen und neuen Vorstädten unserer Tage. Die reich bebilderte thematische Darstellung wird durch 25 exemplarische Fallstudien städtebaulich ambitionierter Siedlungsprojekte seit der Mitte des letzten Jahrhunderts erweitert.