Harald Jung Knihy

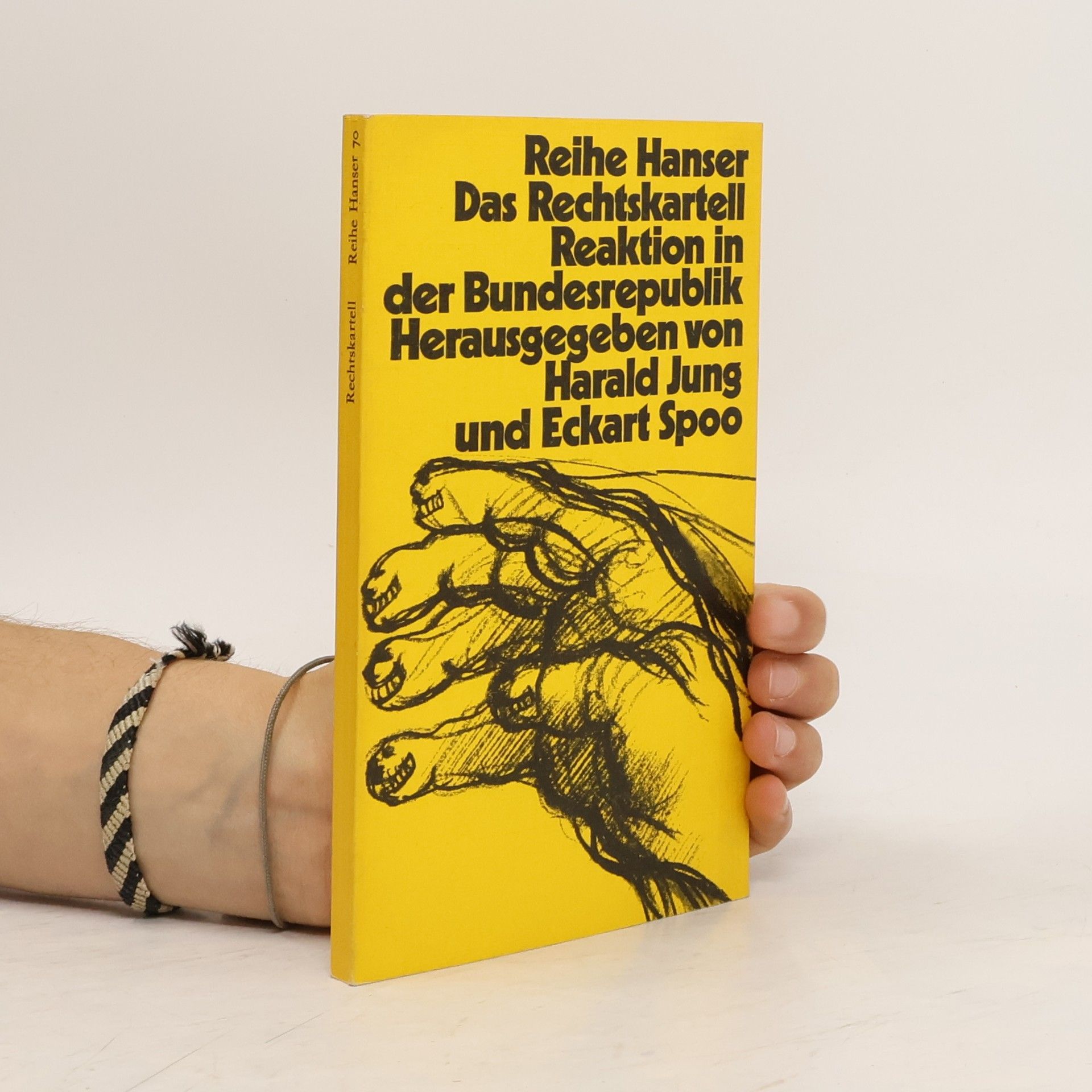
Brave New Work?
Mensch und Arbeit im 21. Jahrhundert
Unsere Arbeitswelt befindet sich erneut im Umbruch, der über technologische Modernisierungen hinausgeht und grundlegende Veränderungen in unserer Lebenswelt und dem wirtschaftlichen Wohlstand mit sich bringt. Die Erfahrungen aus der Corona-Krise und die Herausforderungen einer global vernetzten, komplexen Wirtschaft haben viele Entwicklungen beschleunigt. Zudem erleben wir dramatische demografische Veränderungen und einen Mentalitätswandel bei jüngeren Generationen. Diese Flexibilisierungs- und Innovationsimpulse werfen Fragen auf: Wie werden sie unser Arbeitsleben beeinflussen? Können wir diese Entwicklungen abschätzen und aktiv gestalten? Welche ethischen Aspekte sind in Bezug auf menschliche Arbeit unter den aktuellen Bedingungen zu berücksichtigen? Diese Fragen wurden auf einer multidisziplinären Fachtagung mit Experten aus verschiedenen Bereichen behandelt. Die Beiträge reichen von Praxisstudien innovativer Unternehmen wie SAP bis hin zu Analysen der Arbeitsmarktentwicklung in Deutschland und der Diskussion um ein Bürgergeld. Zu den Autoren zählen renommierte Persönlichkeiten wie Prof. B. Fitzenberger und Prof. M. Frenkel. Die Diskussion fördert eine interdisziplinäre Perspektive auf die zentralen Themen unserer ökonomischen und gesellschaftlichen Zukunft, unter Berücksichtigung grundlegender menschlicher Werte.