Georg Bollenbeck Knihy
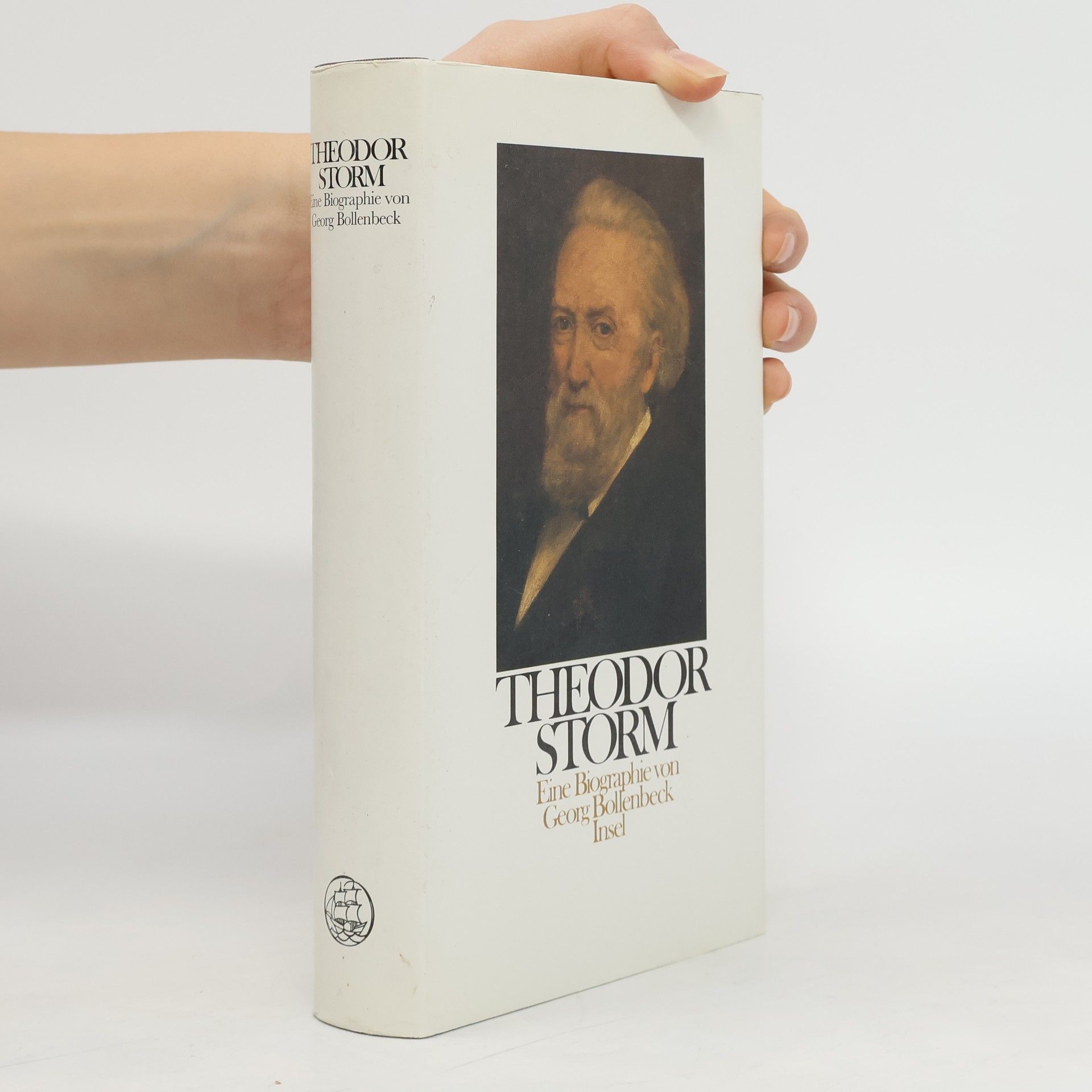
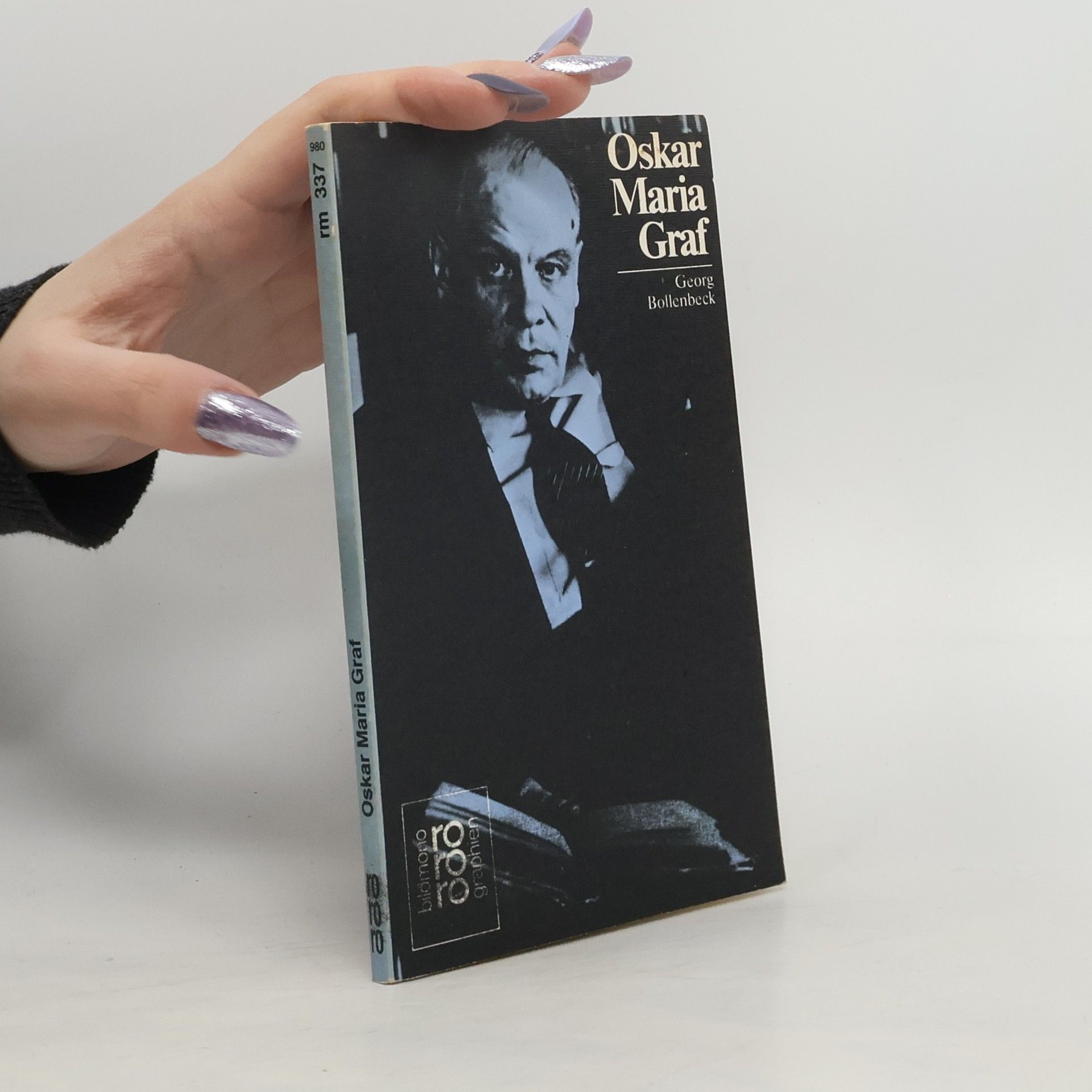

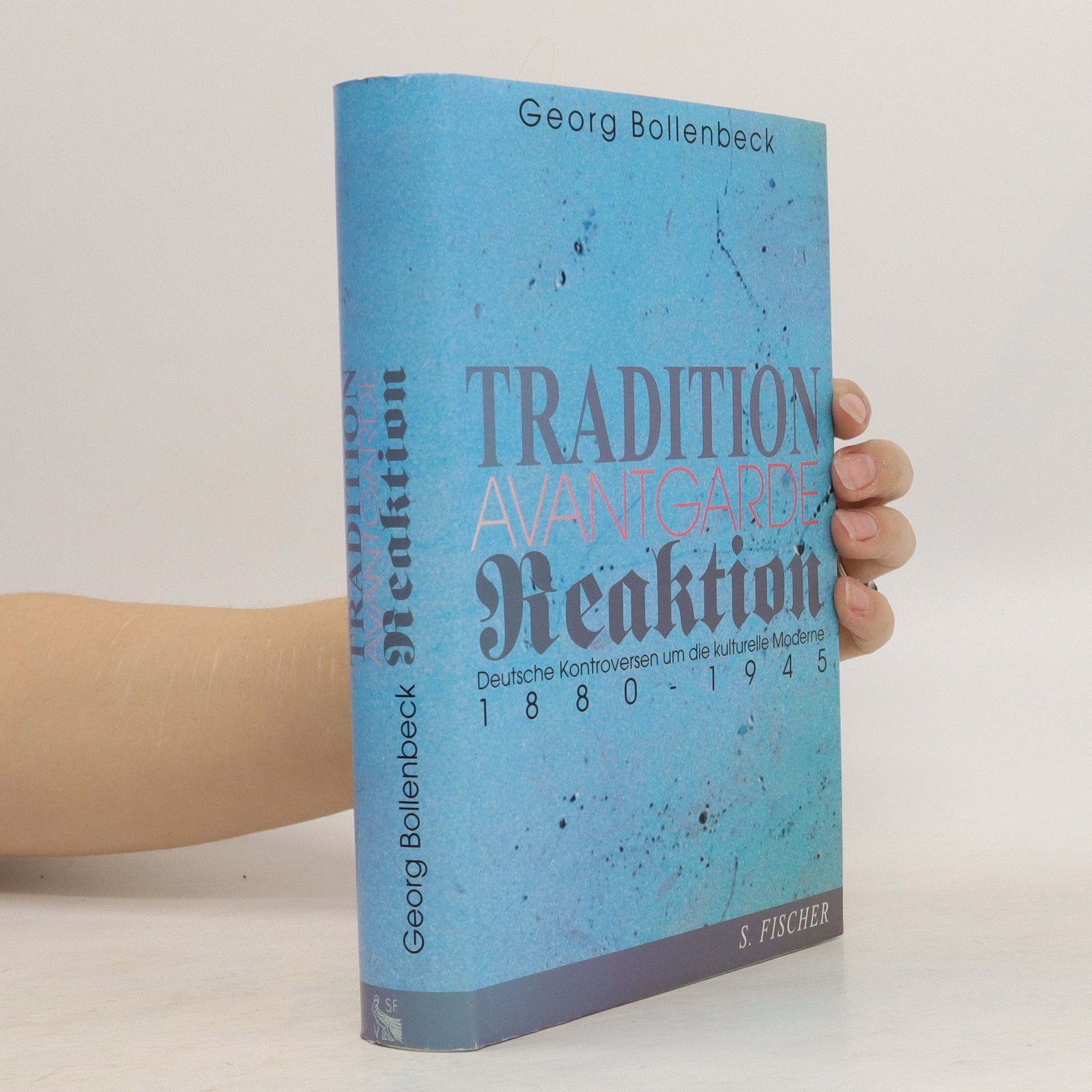
Allgemeiner Verfall, Entfremdung und Vermassung, die Herrschaft des Geldes, der Technik und der Medien: das sind bis heute die Themen der Kulturkritiker. Auch wenn die Traditionen dieses Denkens bis in die Antike zurückreichen, beginnt die eigentliche Zeit der Kulturkritik erst mit der Aufklärung. Auf der Suche nach einer anderen, besseren Moderne erzählen die Kulturkritiker Geschichten vom Verlust. Georg Bollenbeck geht es um die Eigenart dieses unterschätzten und faszinierenden Denkens, das bis heute ungebrochen ist. Er lotet das Spektrum einer provokanten Dauerkommentierung der Moderne in allen ihren scharfsinnigen und problematischen Zeitdiagnosen aus.
„Voralpen-Gorki“, „Lederhosenerzähler“, „bayrischer Boccaccio“, „naiver Stegreiferzähler“. - Etikettierungen dieser Art haften immer noch an Oskar Maria Graf. Er gilt als Naturbursche und Original, als schlitzohriger „Viechskerl“, der als „Porno-Graf“ erotische Schnurren präsentiert oder sich als „Erzähler von Geblüt“ auf „ländliche Sachen“ spezialisiert. Offenbar wird Graf, der fast sechzig Jahre in der Großstadt München und der Weltstadt New York verbrachte, sein provinzielles Lederhosen-Image nicht los. An diesem Bild ist der Autor nicht schuldlos. Oskar Maria Graf liebt die Maskerade, die Rolle des naiven Bauerntölpels oder die des käuflichen Literaten.
Georg Bollenbeck zeichnet ein differenziertes Portrait von Theodor Strom, dem Erzähler des Schimmelreiters , dem Dichter des Kleinen Hävelmann , dem realistischen Zeichner des Pole Poppenspäler oder Carsten Curator und vielen anderen wohlvertrauten Figuren und Szenen, dem Lyriker schließlich. Er stellt Person und Werk des Autors auf dem Hintergrund seiner Zeit dar. Und so entstand eine nach den neuesten Forschungen und Quellen gearbeitete Biographie, ein differenziertes Portrait, ein Gesamtbild, das aus gebührender zeitlicher Distanz mit den verfeinerten Techniken der Darstellung konstruiert wird, die der Literaturhistoriker heute der modernen Geschichtsschreibung verdankt. Von der Dichtungsdeutung bis zur Mentalitätsgeschichte, vom psychoanalytischen Ansatz bis zum soziologischen Zugriff reichen diese Techniken, und sie werden vom Autor dieser Biographie virtuos eingesetzt.