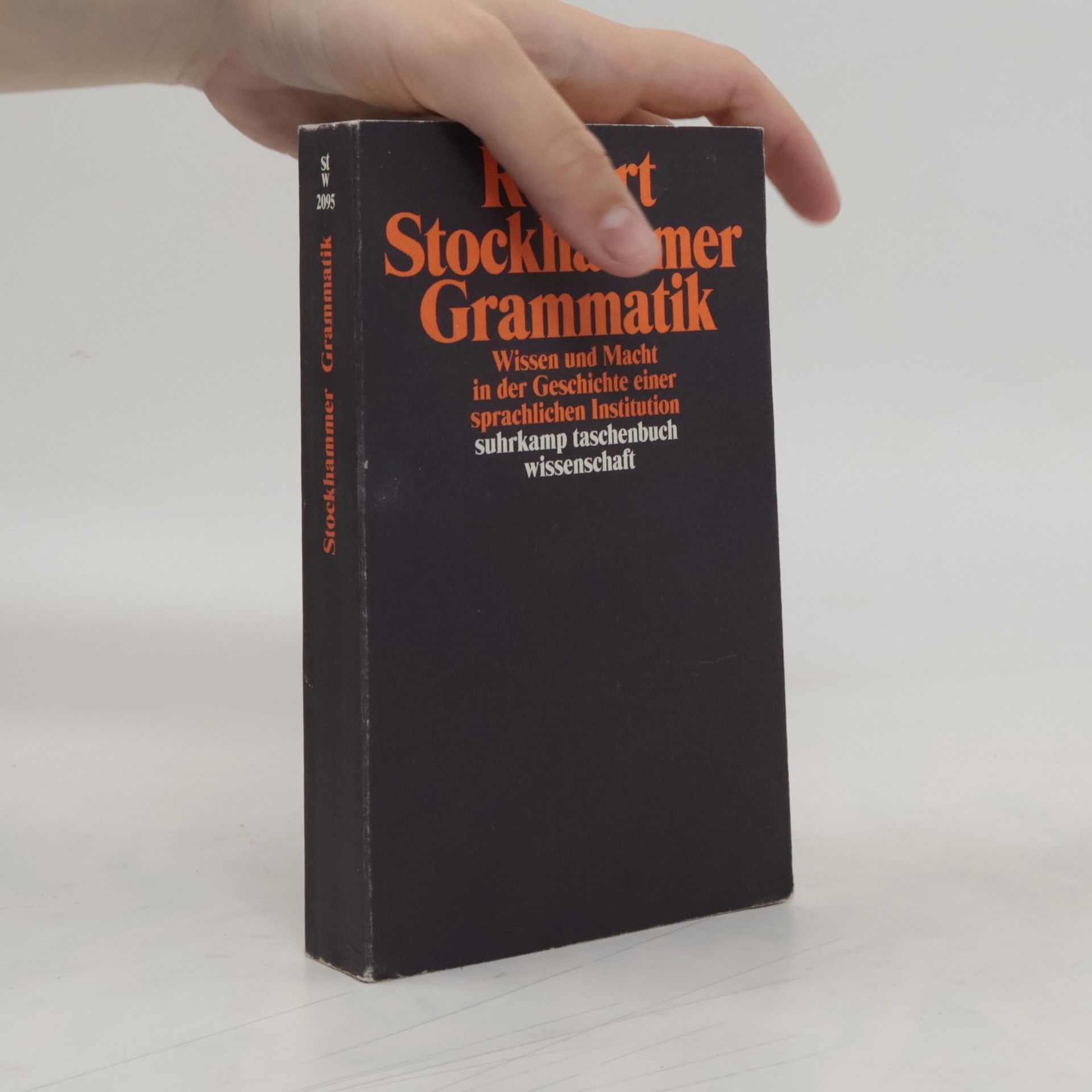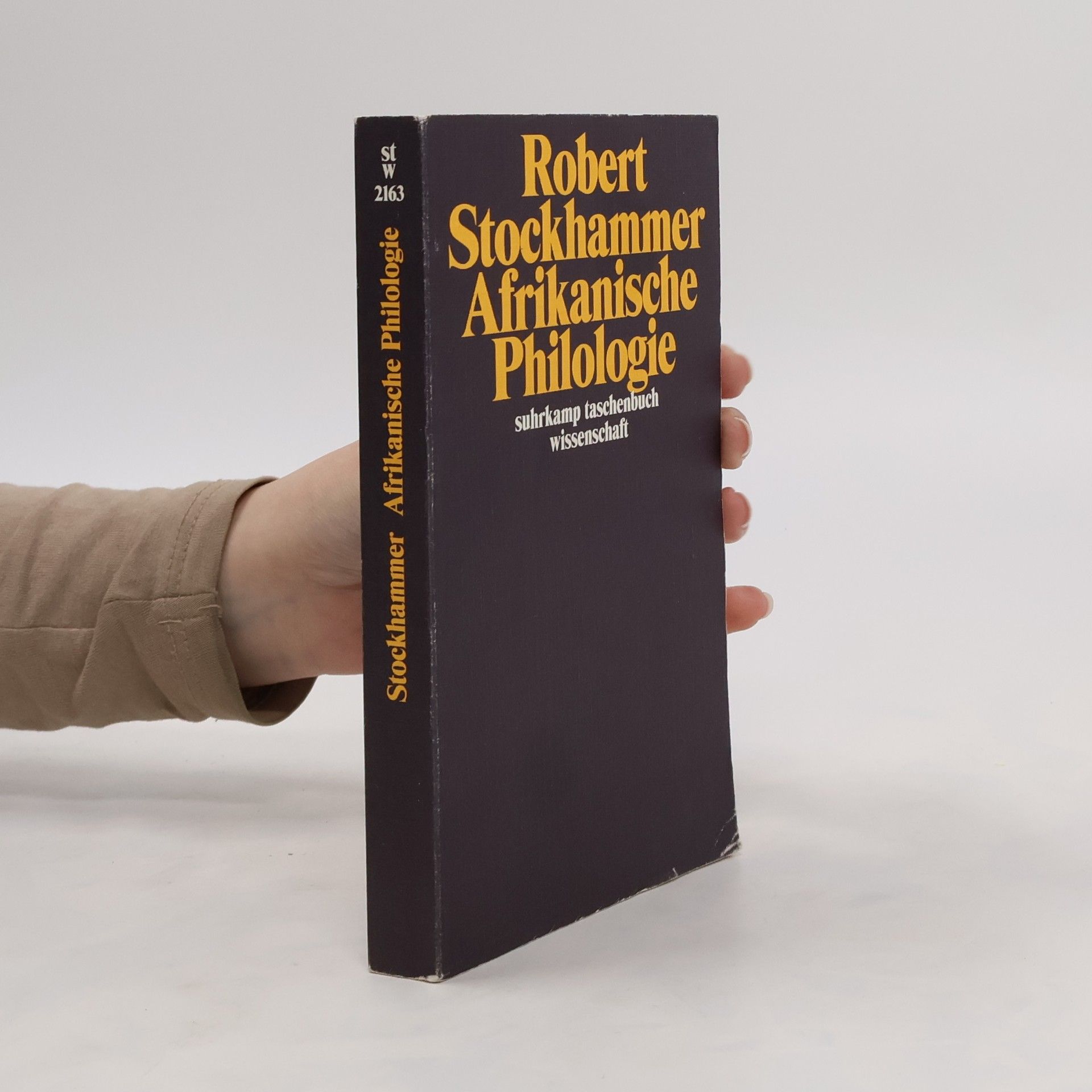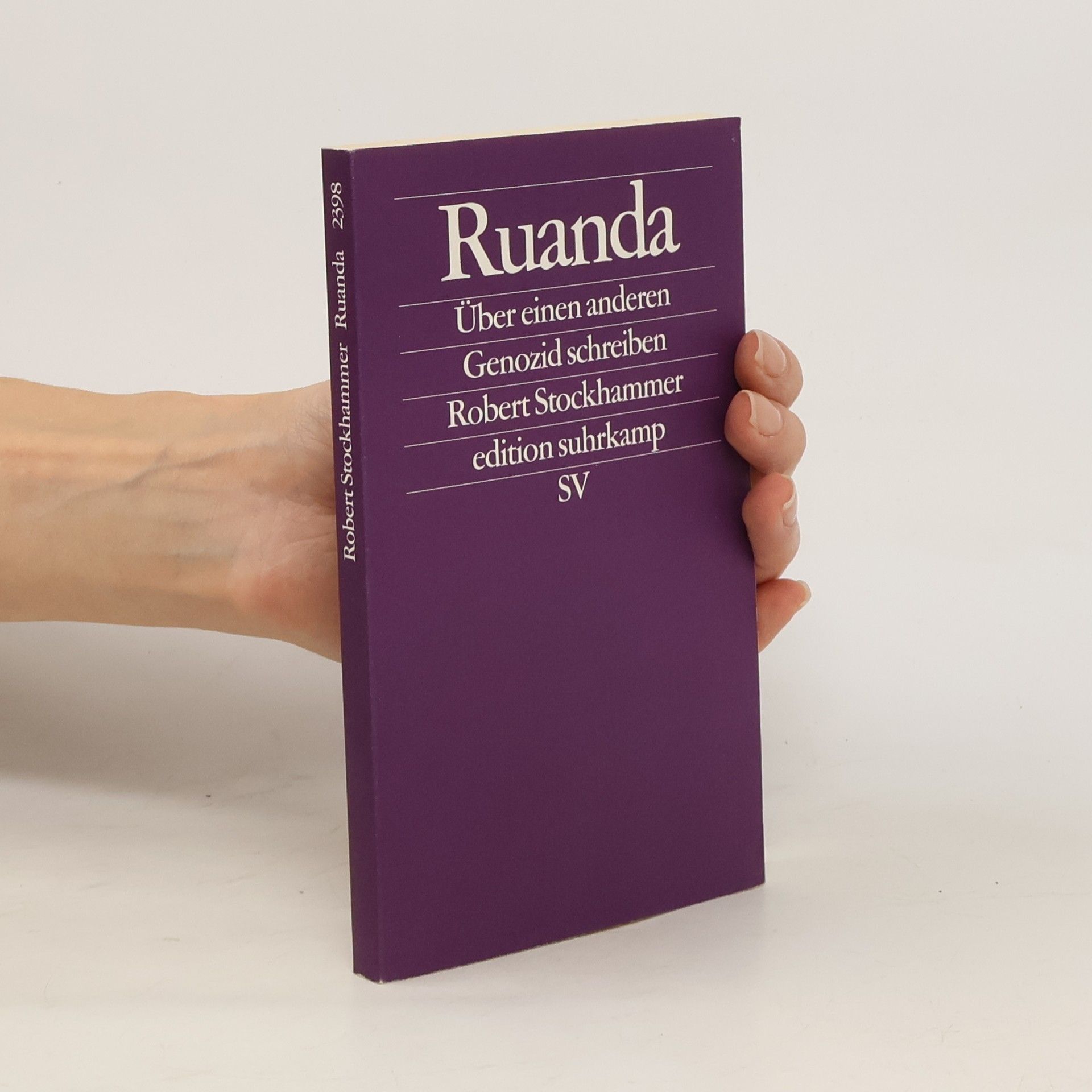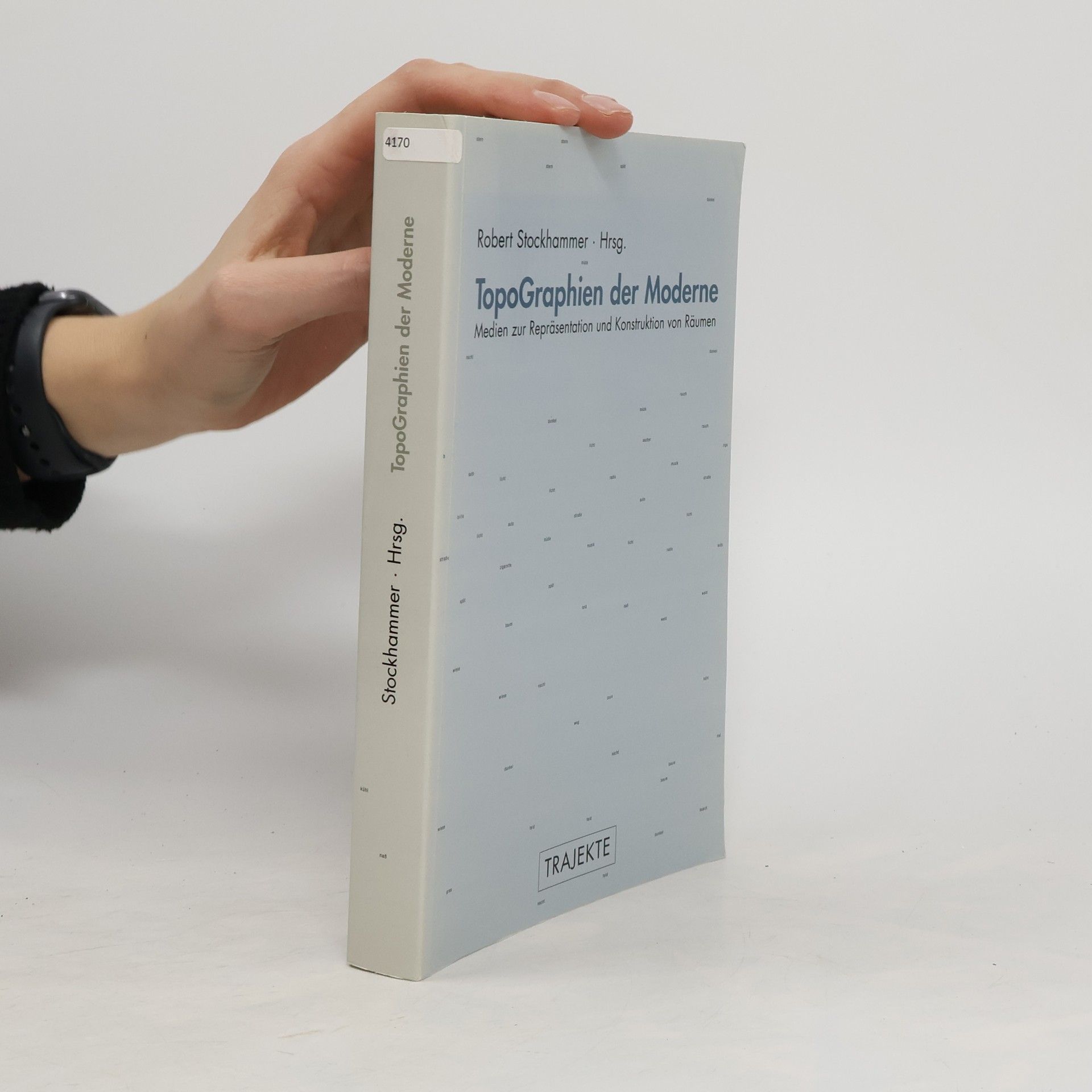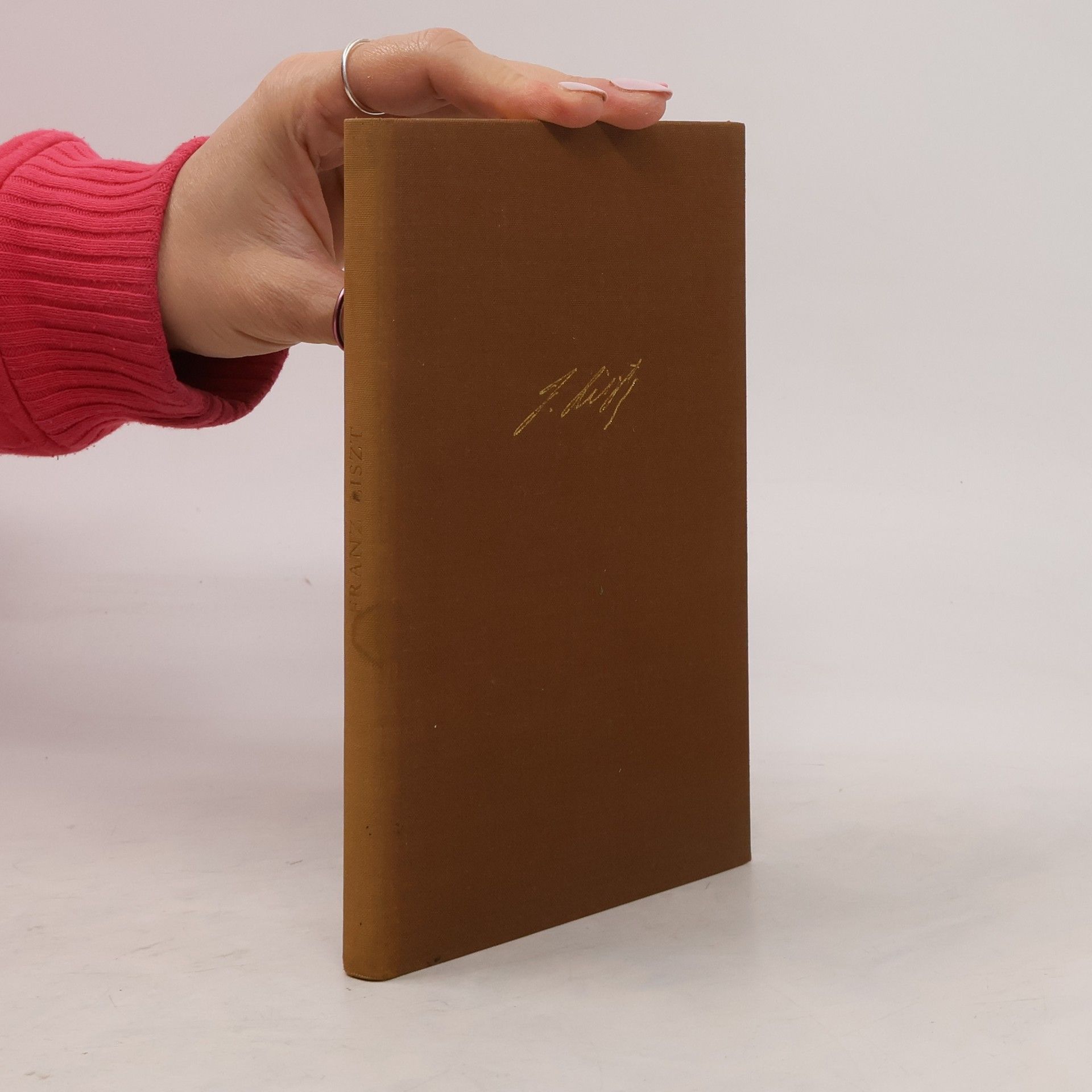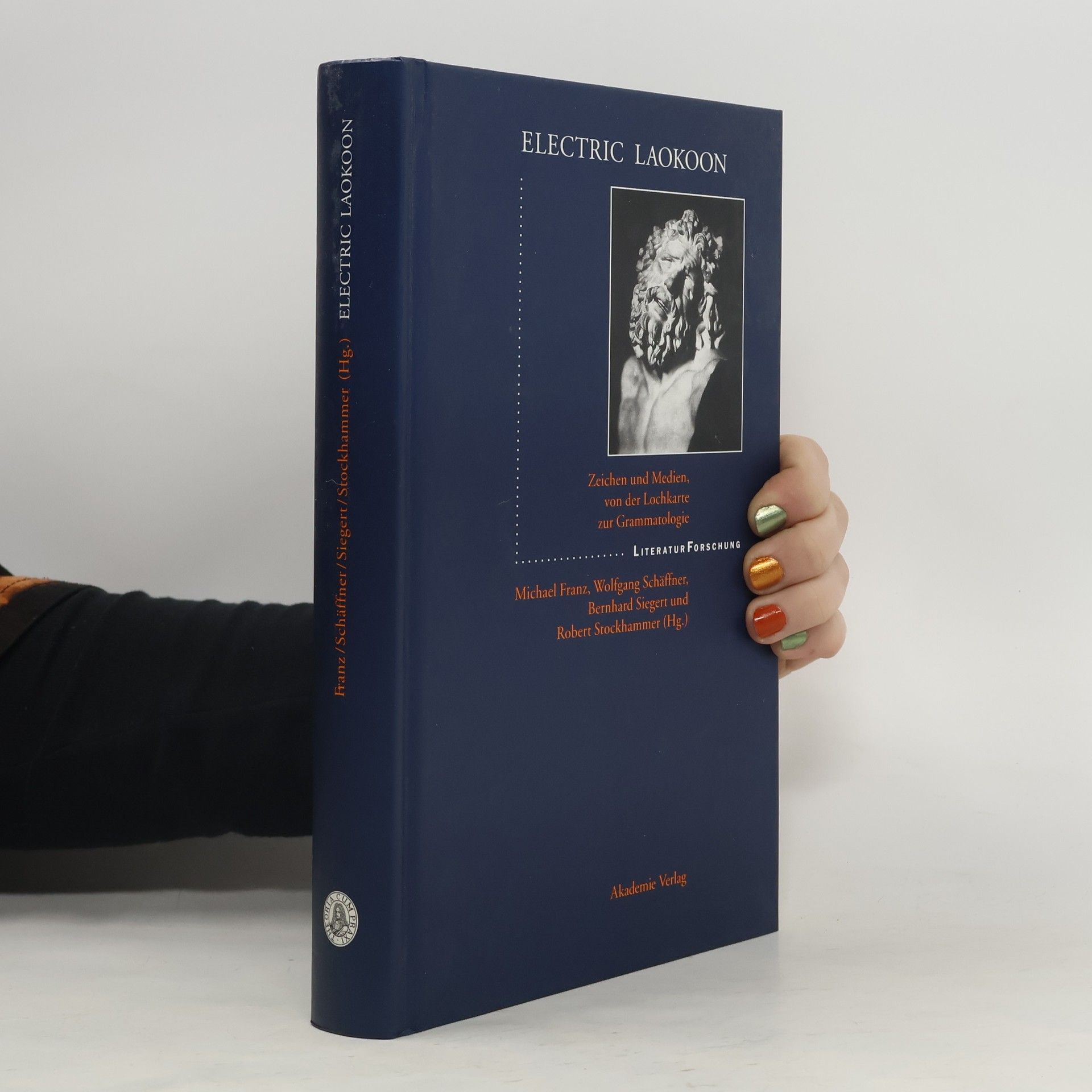Ruanda
Über einen anderen Genozid schreiben
In Ruanda wurden 1994 mindestens 800 000 Menschen ermordet. Im vorliegenden Essay stellt sich Robert Stockhammer der Aporie, daß Vergleiche des Genozids in Ruanda mit der Shoah ebenso problematisch wie unvermeidbar sind. Die Studie lotet deshalb den Vergleichs druck aus, der auf dem Schreiben über diesen »anderen« Genozid in Ruanda lastet. Untersucht werden Bücher, die Afrikaner und Europäer seither darüber geschrieben haben, darunter viele literarische Texte, jedoch auch Zeugnisse von Überlebenden und Reportagen. Statt die Rede vom »Unsagbaren« zu wiederholen, beschreibt diese philologische Studie die Bedingungen der Sagbarkeit. Ein kurzer Abriß zur Geschichte Ruandas seit seiner Kolonialsierung durch das Deutsche Reich steht voran.