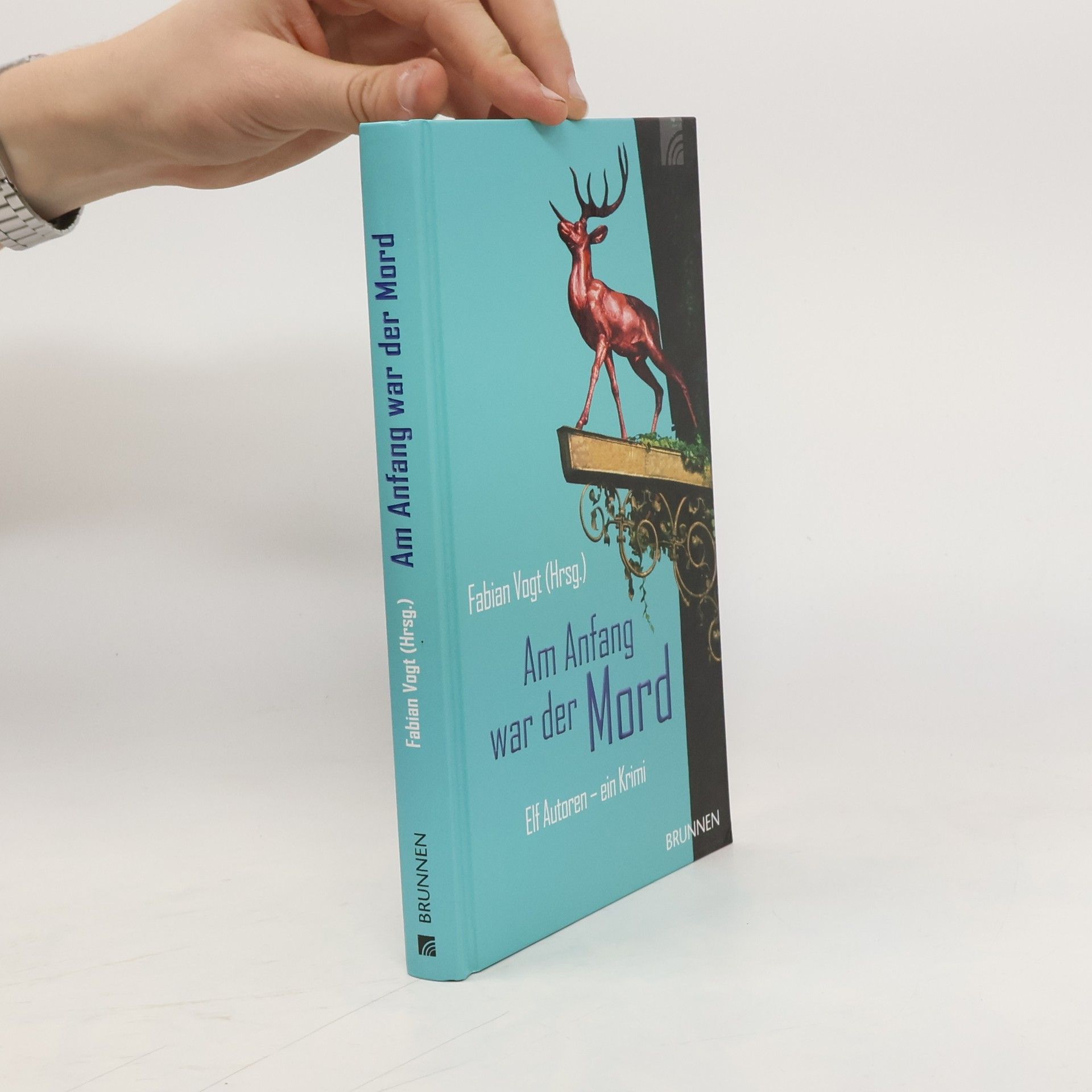Grundlagen einer Theorie der Prosa
Überlegungen zur basalen Selbstreferentialität der Dichtung nach Roman Jakobson
- 394 stránok
- 14 hodin čítania
Die Analyse konzentriert sich auf die basale Selbstreferentialität poetischer Texte und untersucht ein Korpus anspruchsvoller Prosatexte. Diese Texte zeichnen sich durch ihre umfangreiche und komplexe Struktur aus und folgen einer dichten, dynamischen Semiose. Ziel ist es, die theoretischen Grundlagen der Prosa zu beleuchten und deren besondere Merkmale zu erfassen, die sie von anderen Textformen abheben.