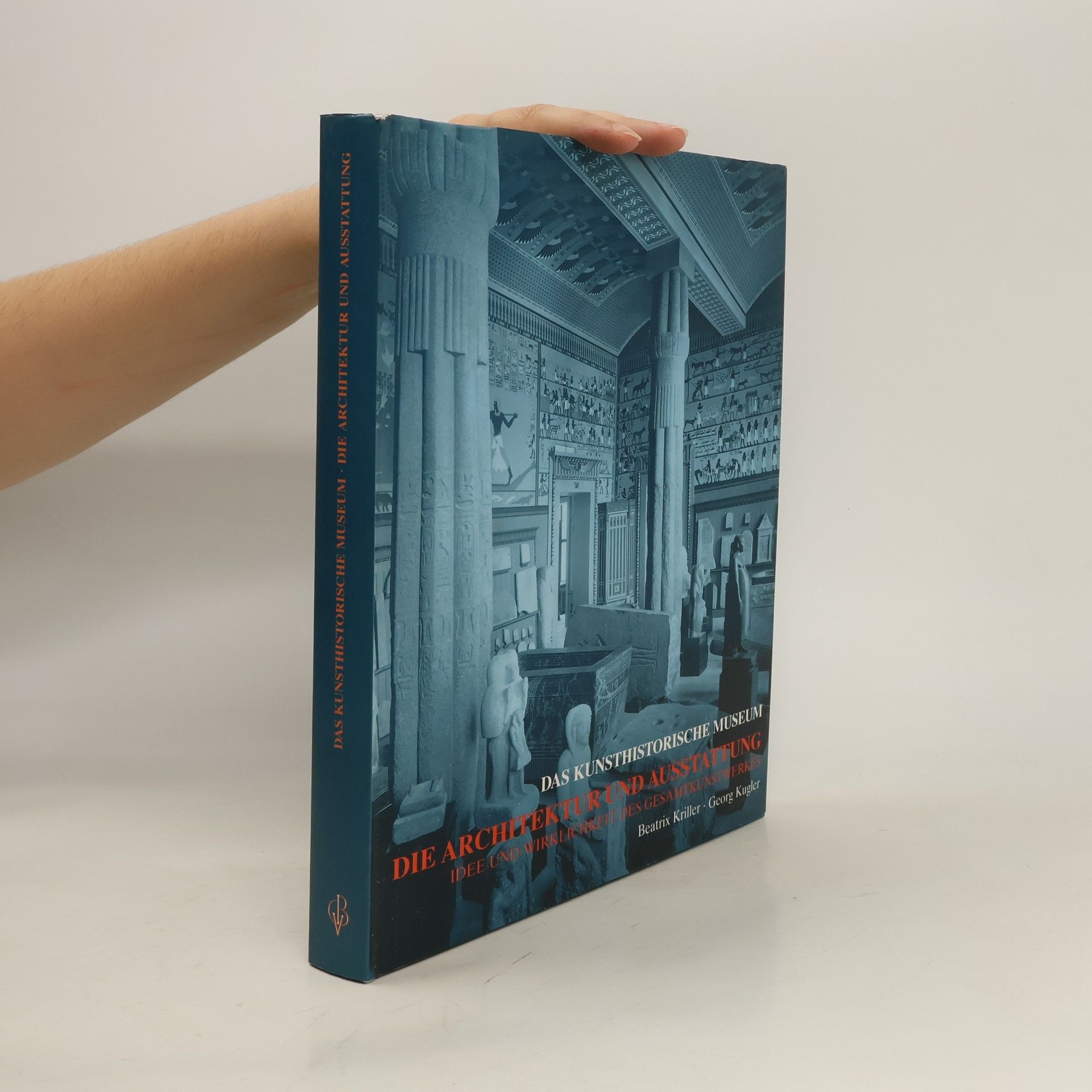Das Kunsthistorische Museum wurde im Kriegsjahr 1945 durch Bomben, Brand und Besatzung schwer beschädigt. Eine Chronologie in Bildern zeigt nun erstmals die dramatischen Ereignisse zwischen Zerstörung und Wiederaufbau. Anschaulich und für den Leser nachvollziehbar werden die dramatischen Ereignisse um das Kunsthistorische Museum in Wien im Kriegsjahr 1945 aufbereitet. Das Museum und die ihm angegliederten Sammlungen in Schönbrunn und in der Neuen Burg stehen im Mittelpunkt der Darstellung. Dennoch werden die Ereignisse dieses Schlüssjahres in einen größeren Zusammenhang gestellt.
Herbert Haupt Knihy






Ein Herr von Stand und Würde
Fürst Johann Adam Andreas von Liechtenstein (1657-1712). Mosaiksteine eines Lebens
Fürst Johann Adam Andreas von Liechtenstein (1657-1712) zählt zu den prägenden Persönlichkeiten an der Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert. Ausgestattet mit besonderen ökonomischen Fähigkeiten und begünstigt vom Wirtschaftsaufschwung der Zeit, vermehrte Johann Adam Andreas seine Einkünfte und galt schon bald als einer reichsten Fürsten seiner Zeit. In kluger Abgrenzung vom Wiener Hof sah Johann Adam Andreas seine Hauptaufgabe in der steten Vermehrung des Grundbesitzes. Als Bauherr der liechtensteinischen Palais in der Bankgasse und in der Roßau wetteiferte Johann Adam Andreas mit seinem Freund, dem Prinzen Eugen von Savoyen-Carignan. Bleibende Bedeutung erlangte Fürst Johann Adam Andreas durch den Erwerb der reichsfreien Herrschaften Schellenberg und Vaduz. Er schuf damit die Grundlage für das heutige souveräne Fürstentum Liechtenstein.
Johann Adam I. Andreas von Liechtenstein (1656-1712) galt schon den Zeitgenossen als Idealbild eines barocken Fürsten. In ihm verbanden sich wirtschaftliches Denken mit der Freude an barocker Repräsentation. Das Hauptaugenmerk des Fürsten lag in der Bautätigkeit, wofür das von ihm in Auftrag gegebene Gartenpalais in der Roßau und das Stadtpalais „hinterm Landhaus“ ein beredtes Zeugnis ablegen. Daneben war Johann Adam I. Andreas ein leidenschaftlicher Freund, Kenner und Sammler von Gemälden und Werken der Bildhauerei. Er führte die von seinem Vater, Fürst Karl Eusebius (1611-1684), geerbten berühmten Gestüte fort, vermehrte den Grundbesitz der Familie in Böhmen, Mähren und Niederösterreich und wurde durch den Kauf der Herrschaften Schellenberg und Vaduz zum Ahnherrn des Fürstentums Liechtenstein.
Die prominentesten Vertreter des Hauses Liechtenstein werden in einer Reihe von Einzelbiografien gewürdigt. Den Anfang macht Karl Eusebius von Liechtenstein, der sich um die Kunstsammlung des Fürstenhauses besonders verdient gemacht hat.
Herbert Haupt ; Mit Einem Beitrag Von Wilfried Seipel ; [herausgegeben Vom Kunsthistorischen Museum Wien]. Includes Bibliographical References (p. 262-264) And Index.