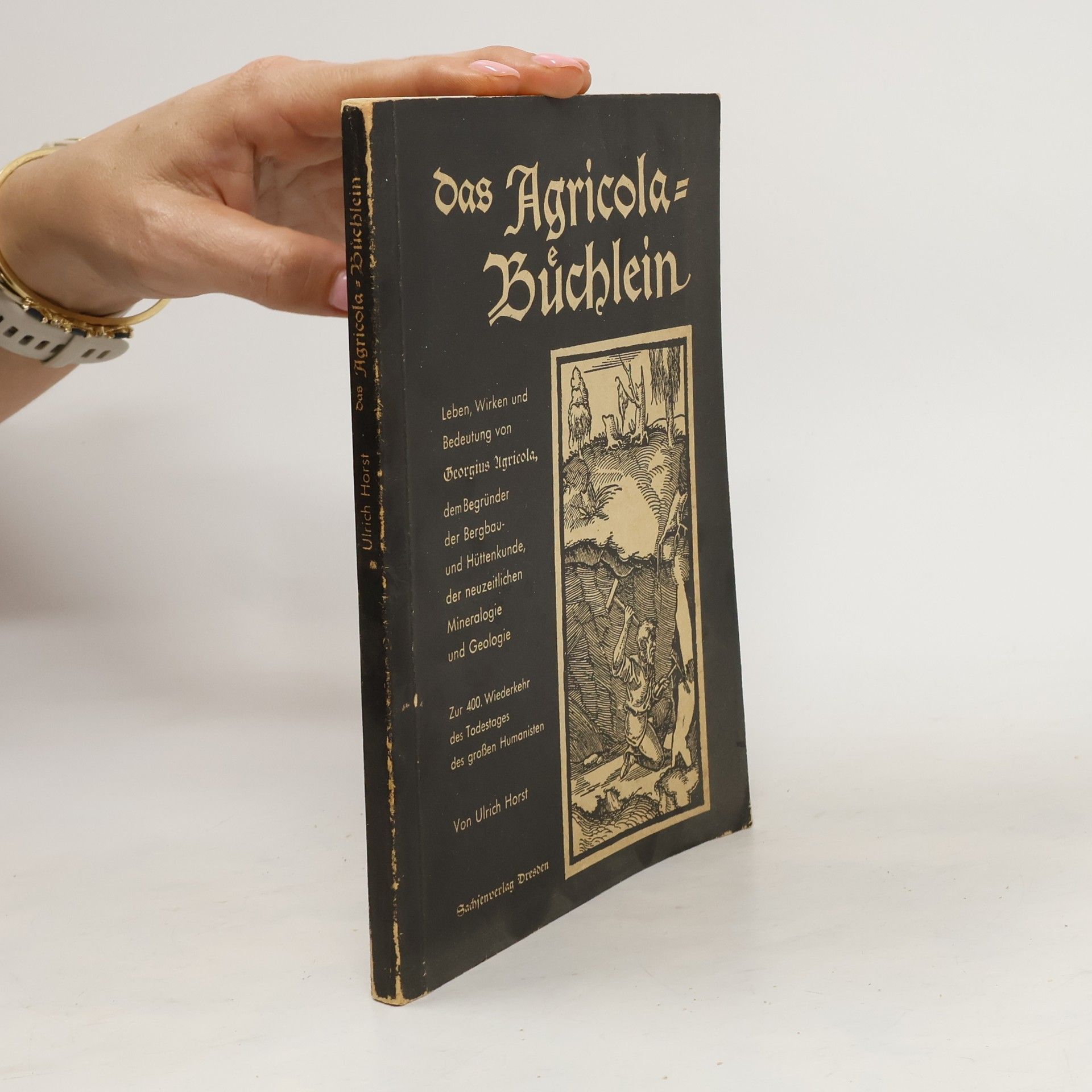Dominicans and the Pope
Papal Teaching Authority in the Medieval and Early Modern Thomist Tradition
- 146 stránok
- 6 hodin čítania
The book explores the Dominicans' official and evolving perspectives on the pope's teaching authority, highlighting internal differences within the order and contrasting their views with those of the Franciscans and Jesuits. Through this examination, it sheds light on the complexities of doctrinal interpretation and authority in the Catholic Church, offering insights into the historical and theological debates that have shaped Dominican thought.