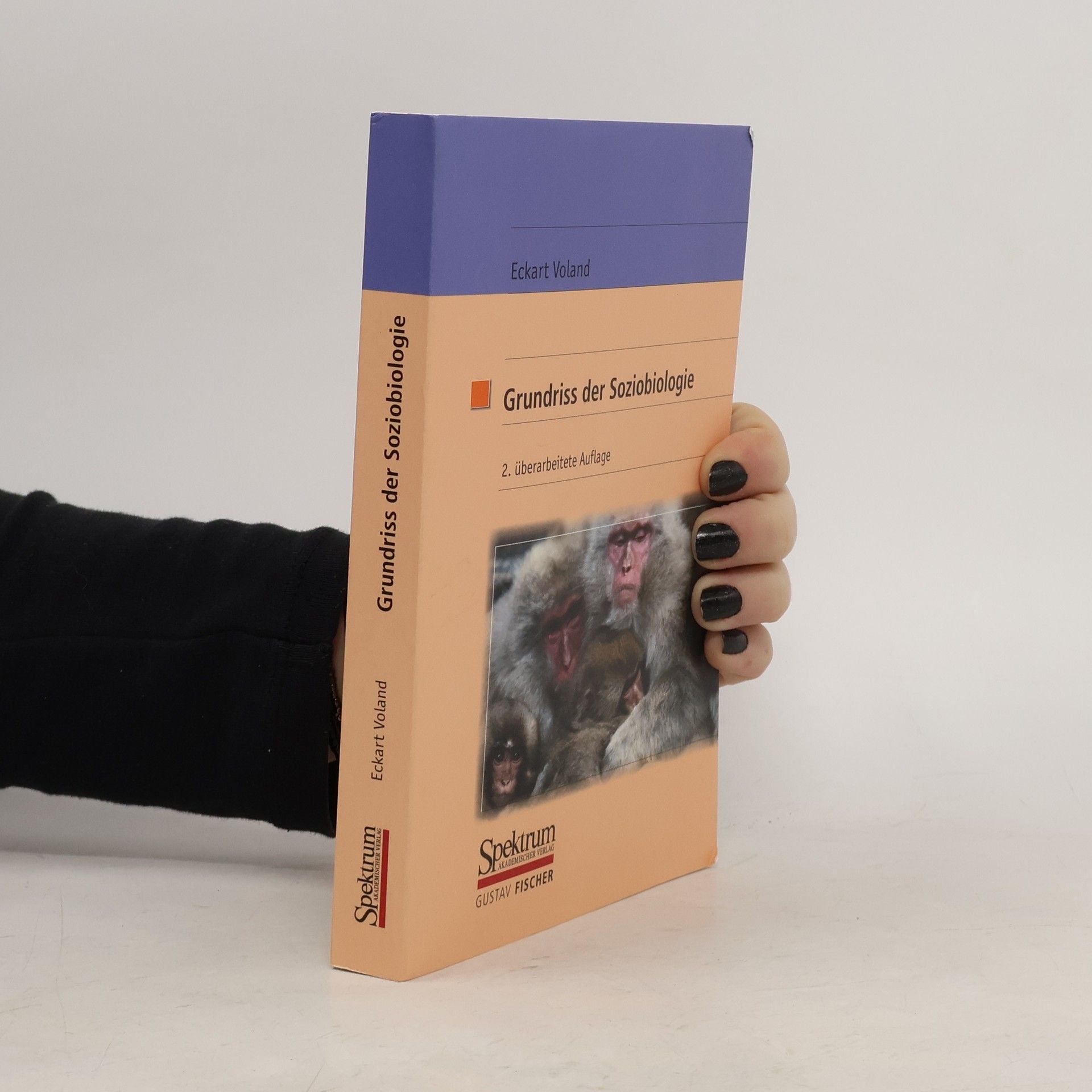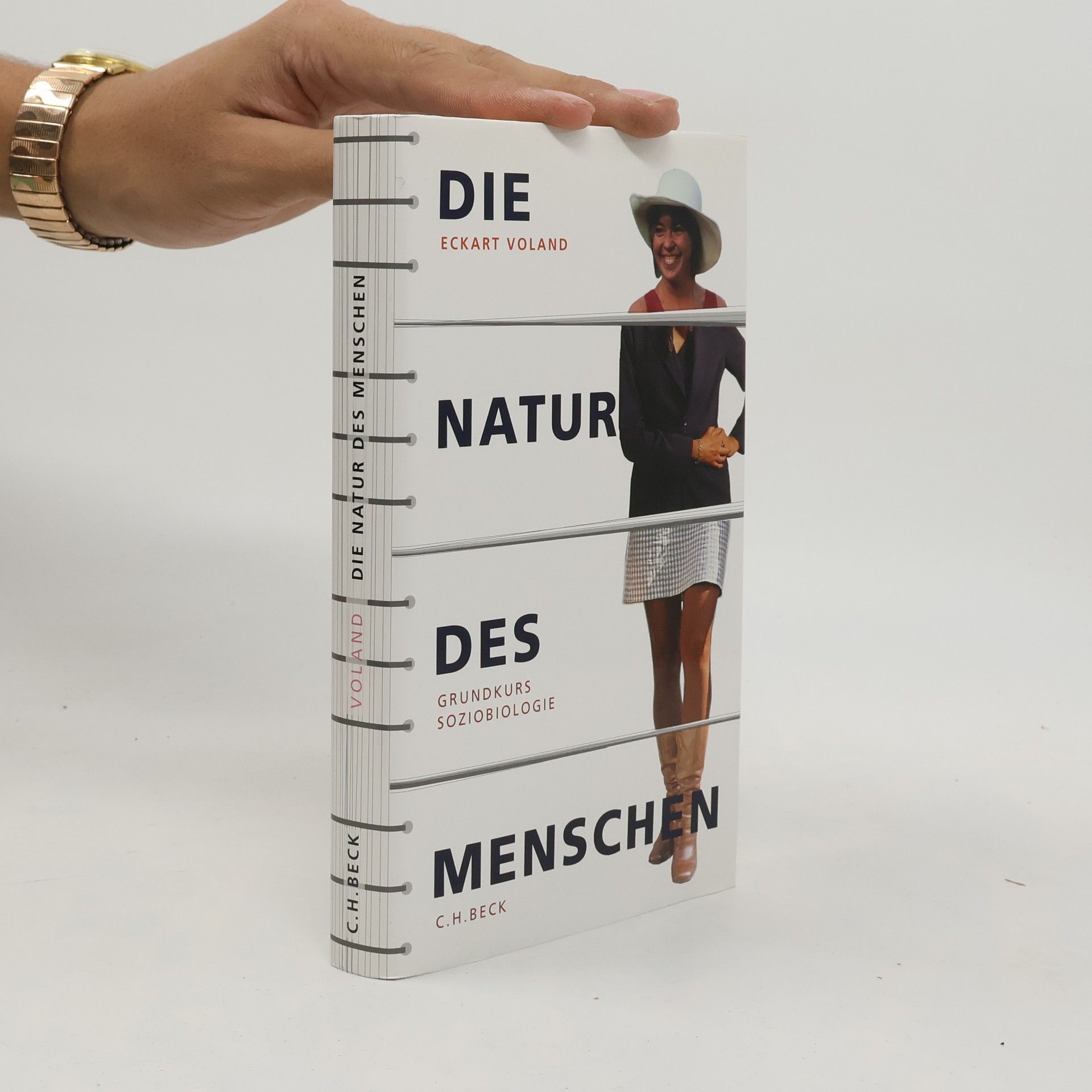Die Natur des Menschen
- 174 stránok
- 7 hodin čítania
Gerade in seiner Kultur zeigt sich die Natur des Menschen. Mit dem Mut zur pointierten Darstellung vermittelt Eckart Voland auf unterhaltsame Weise die grundlegenden Erkenntnisse der jungen und spannenden Wissenschaft der Soziobiologie. Die Zeiten ändern sich, und der Mensch paßt sein Verhalten den sich wandelnden Umständen an. Er erweist sich als lernfähig, ist er aber auch belehrbar? Die Soziobiologie, die das soziale Tier im Menschen entdeckt hat, lehrt uns Skepsis vor allzu hochfliegenden Erwartungen an die Entwicklungsfähigkeit des Menschen: Der Mensch lernt nur, was er auch lernen soll, das heißt, er lernt das, was lange Evolutionsprozesse als lernenswert ausgewählt haben. In 18 kurzen Kapiteln beschreibt der renommierte Soziobiologe Eckart Voland, welche Kriterien und Mechanismen diese Auswahl bestimmen. Wie kommt es zu menschlichen Neigungen wie Barmherzigkeit, Großmut und Solidarität, die es einem naiven (und falschen) Verständnis von Evolution zufolge gar nicht geben dürfte? Wie läßt sich die Bevorzugung monogamer Ehen erklären? Warum ist Fortpflanzungserfolg nicht unbedingt von der Zahl der Nachkommen abhängig? Und wie erklärt sich unsere Unfähigkeit zu dauerhaftem Glück?