Auschwitz, Majdanek und die anderen Konzentrationslager sind das Symbol des unmenschlichen NS-Regimes. Hier verknüpfte sich die terroristische Unterdrückung innenpolitischer Gegner mit der Vernichtungspolitik gegenüber den europäischen Juden und anderen ethnischen und sozialen Gruppen. Zahlreiche Publikationen, von Überlebenden und Historikern, haben das Grauen dokumentiert. Aber der Kenntnisstand über die Entwicklungsgeschichte und die Struktur der KZ blieb gering. Das änderte sich erst ab den sechziger Jahren, als nach den großen Strafprozessen in Israel und Deutschland die ersten Gesamtdarstellungen des Lagersystems erschienen. Diese Untersuchungen halten der historischen Forschung von heute allerdings nicht mehr in vollem Umfang stand. Haben die nationalsozialistischen Konzentrationslager ein System gebildet? Und wenn ja: Was waren seine Charakteristika, verfügte es über identische Strukturen? Karin Orth zeigt, dass die Entwicklung der KZ keineswegs linear verlaufen ist. Detailliert und übersichtlich schildert sie die unterschiedlichen Perioden, die zu differierenden Ausrichtungen in der Unterdrückungspolitik führten.
Karin Orth Knihy
1. január 1963
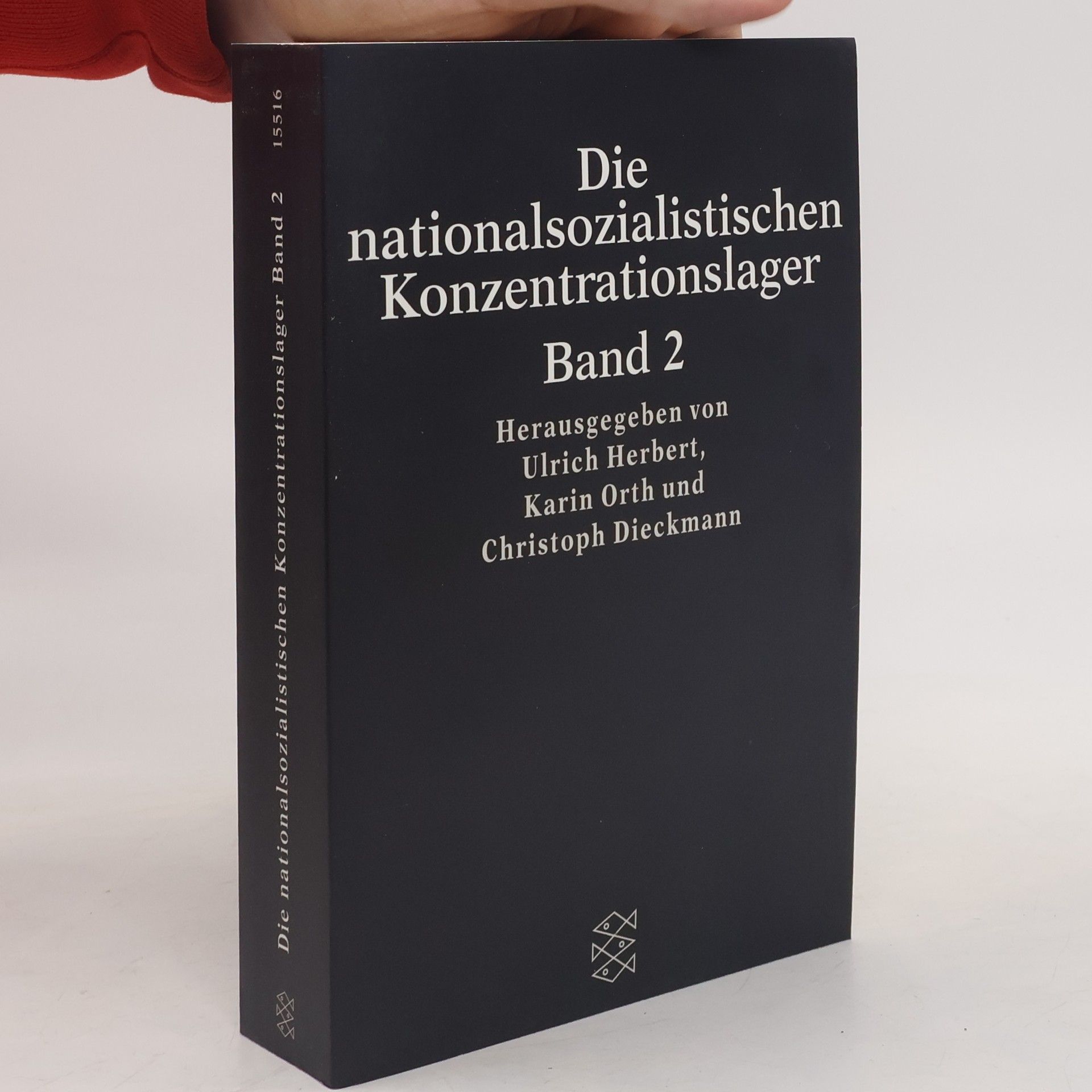


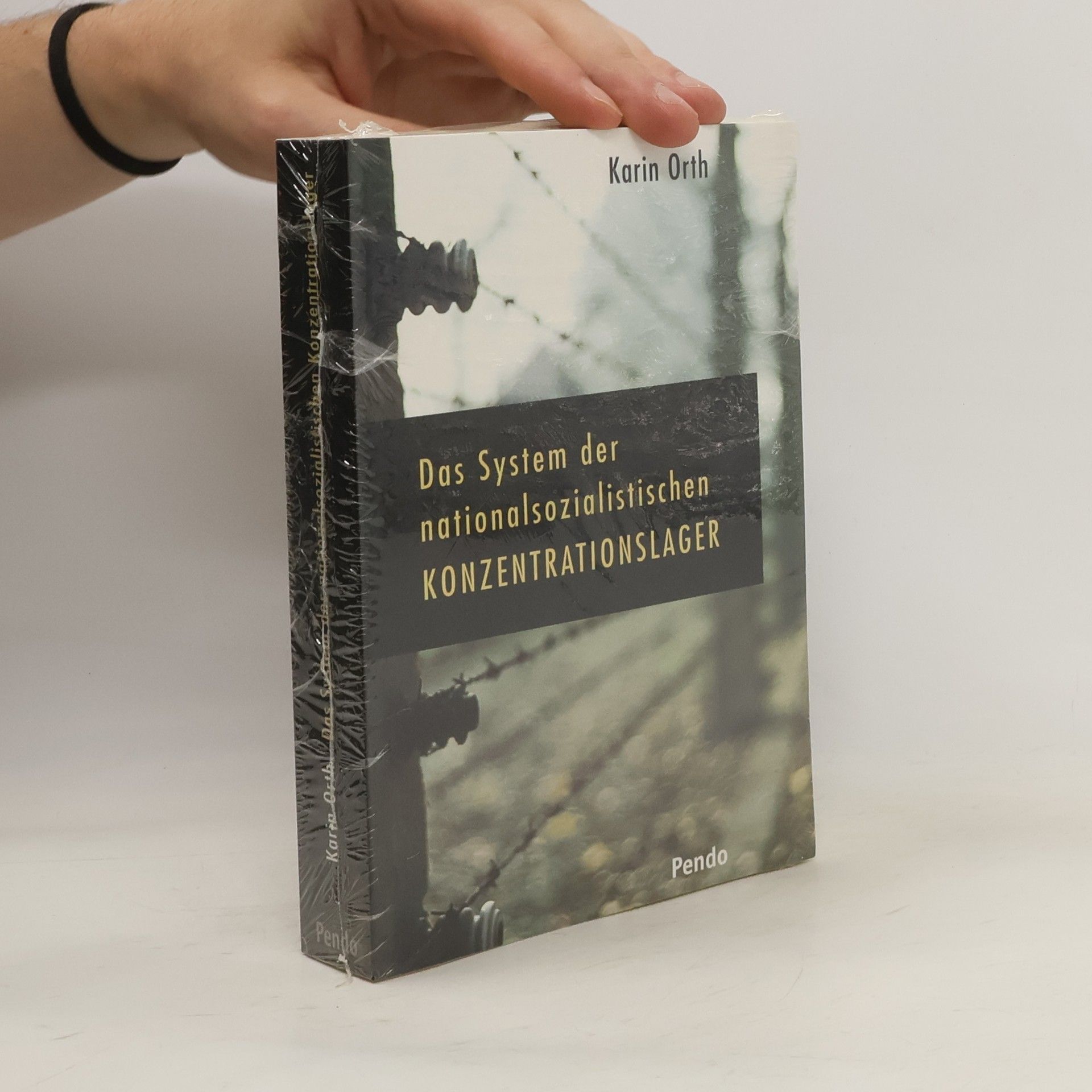
Nichtehelichkeit als Normalität
Ledige badische Mütter in Basel im 19. Jahrhundert
Die nationalsozialistischen Konzentrationslager
- 659 stránok
- 24 hodin čítania
German