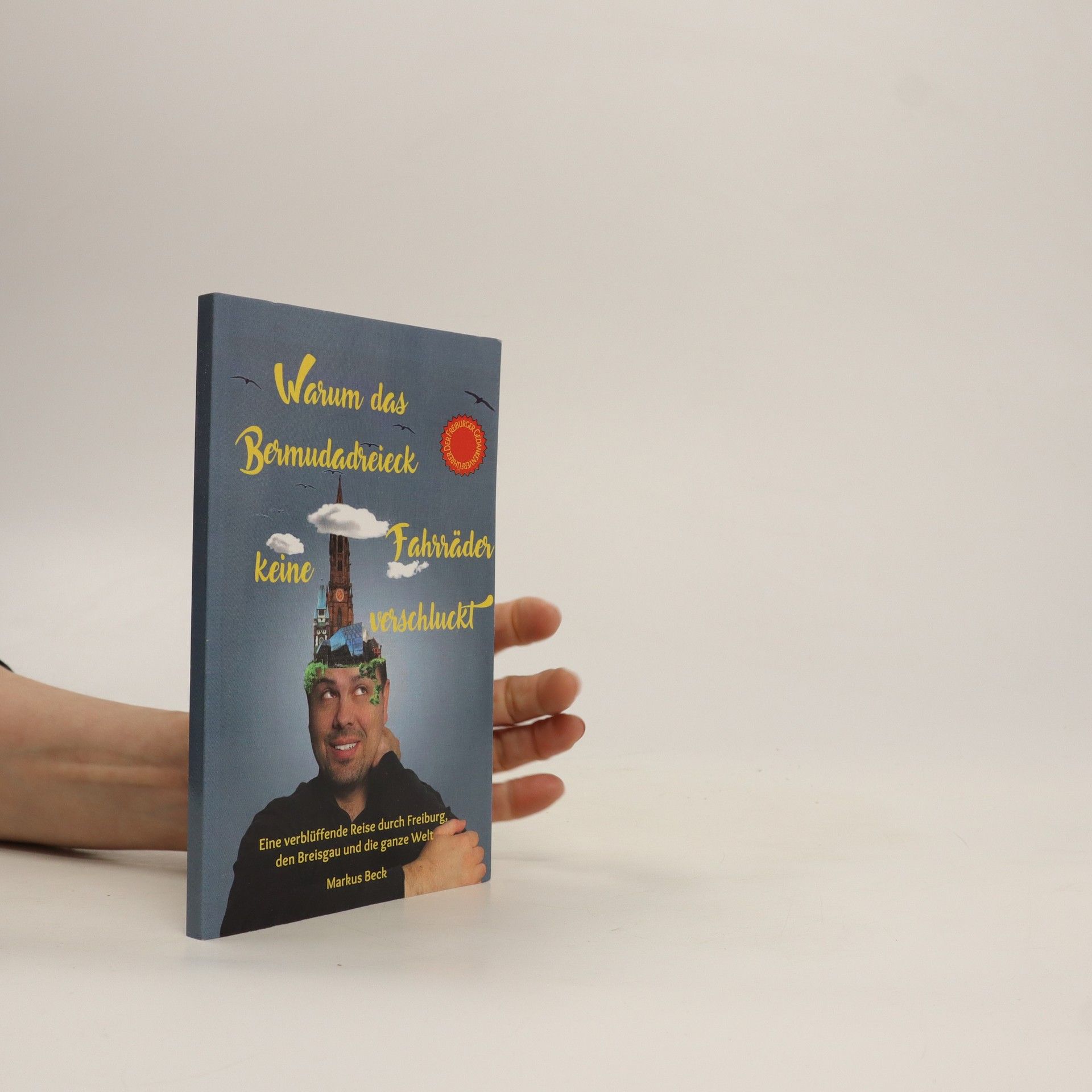ZPO
Zivilprozessordnung - - Kommentar
Die neue Auflage dieses ZPO-Standardwerks richtet sich an Praktiker und bietet eine prägnante, übersichtliche und praxisorientierte Darstellung des Zivilprozessrechts. Sie enthält zahlreiche Fallbeispiele, Formulierungsvorschläge und Praxishinweise zu Themen wie Prozesstaktik und Gebührenfragen. Aktuelle gesetzliche Änderungen, darunter die Regelung zur Wertgrenze für Nichtzulassungsbeschwerden und Anpassungen im Datenschutzrecht, sind umfassend integriert. Dieses Werk verspricht, die Leser schnell auf den neuesten Stand der Rechtsprechung zu bringen.