Sprachbildung im Sachunterricht der Grundschule
Mit dem Scaffolding-Konzept unterwegs zur Bildungssprache
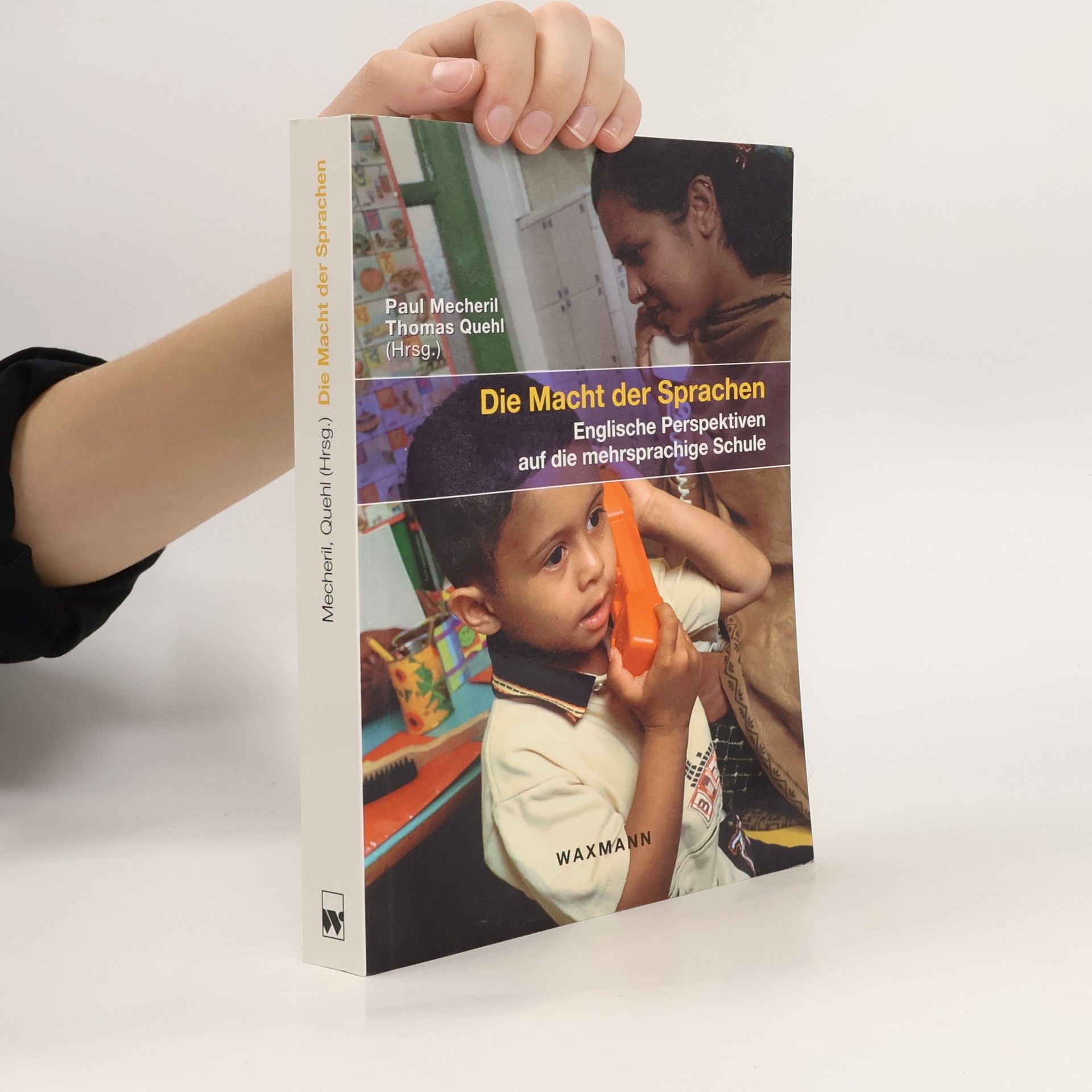

Mit dem Scaffolding-Konzept unterwegs zur Bildungssprache
Englische Perspektiven auf die mehrsprachige Schule
Die Fähigkeit von Schulen, auf die wachsende Herausforderung der Mehrsprachigkeit ihrer Schülerinnen und Schüler zu reagieren, hängt nicht nur von Didaktik und Schulentwicklung ab. Die gesammelten Beiträge verdeutlichen, dass Reformen auch eine Reflexion und Veränderung der Macht- und Dominanzverhältnisse erfordern, die in Schulen und der Einwanderungsgesellschaft bestehen. Ein Blick auf Großbritannien bietet sowohl theoretische als auch praktische Anregungen. Die Themen umfassen bildungspolitische Maßnahmen zur Chancengleichheit, den Zweitspracherwerb sowie die Sprach- und Machtverhältnisse in Schulen. Weitere Aspekte sind die Bedingungen für inklusive Schulen, die Risiken einer marktwirtschaftlich orientierten Bildungspolitik, Konzepte der Zweitsprachdidaktik, sprachliche Diversität im Unterricht und die Beziehungen zwischen Eltern, Familien und Schulen. In acht Kommentaren deutscher Autorinnen und Autoren werden die Erfahrungen und Positionen aus dem englischsprachigen Raum im Kontext der Situation in Deutschland analysiert. Die Beiträge stammen von Experten wie Georg Auernheimer, Christiane Bainski, Adrian Blackledge und vielen anderen, die relevante Perspektiven zu diesen wichtigen Themen bieten.