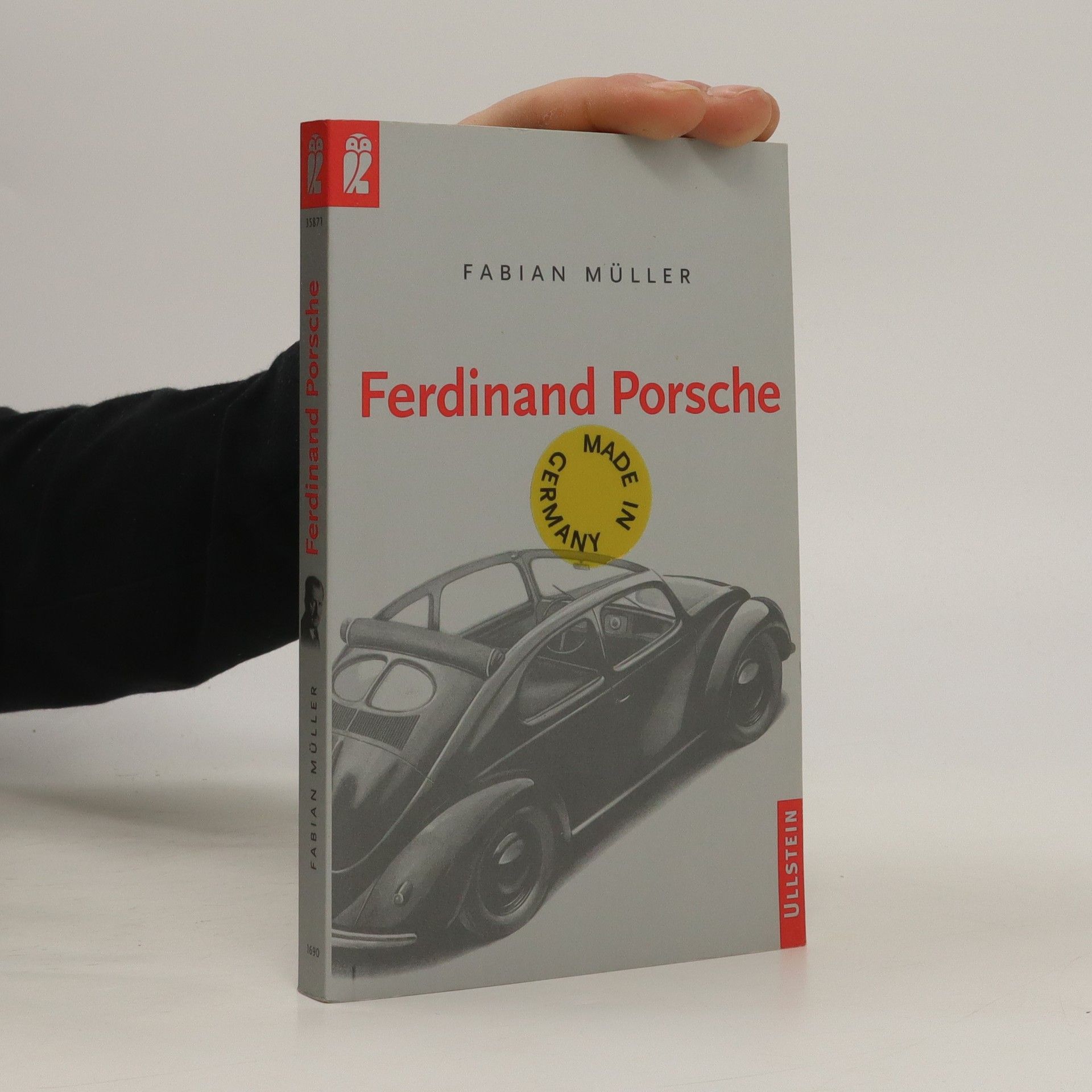Unwetterlagen effizient bewältigen
Organisatorische und taktische Hinweise für Feuerwehren
- 244 stránok
- 9 hodin čítania
Die Organisation und Führung von Feuerwehreinsätzen bei extremen Unwettern stehen im Mittelpunkt des Buches. Der Autor präsentiert ein mehrstufiges Unwetterkonzept, das für Feuerwehren jeder Größe anwendbar ist. Er erläutert einsatztaktische Kriterien und organisatorische Maßnahmen für eine effektive Bewältigung von Unwettersituationen auf lokaler Ebene. Die zweite Auflage enthält ein neues Stufenkonzept für Anlauf- und Notfallmeldestellen und bietet umfangreiche digitale Vorlagen zum Download, um die Implementierung zu unterstützen.