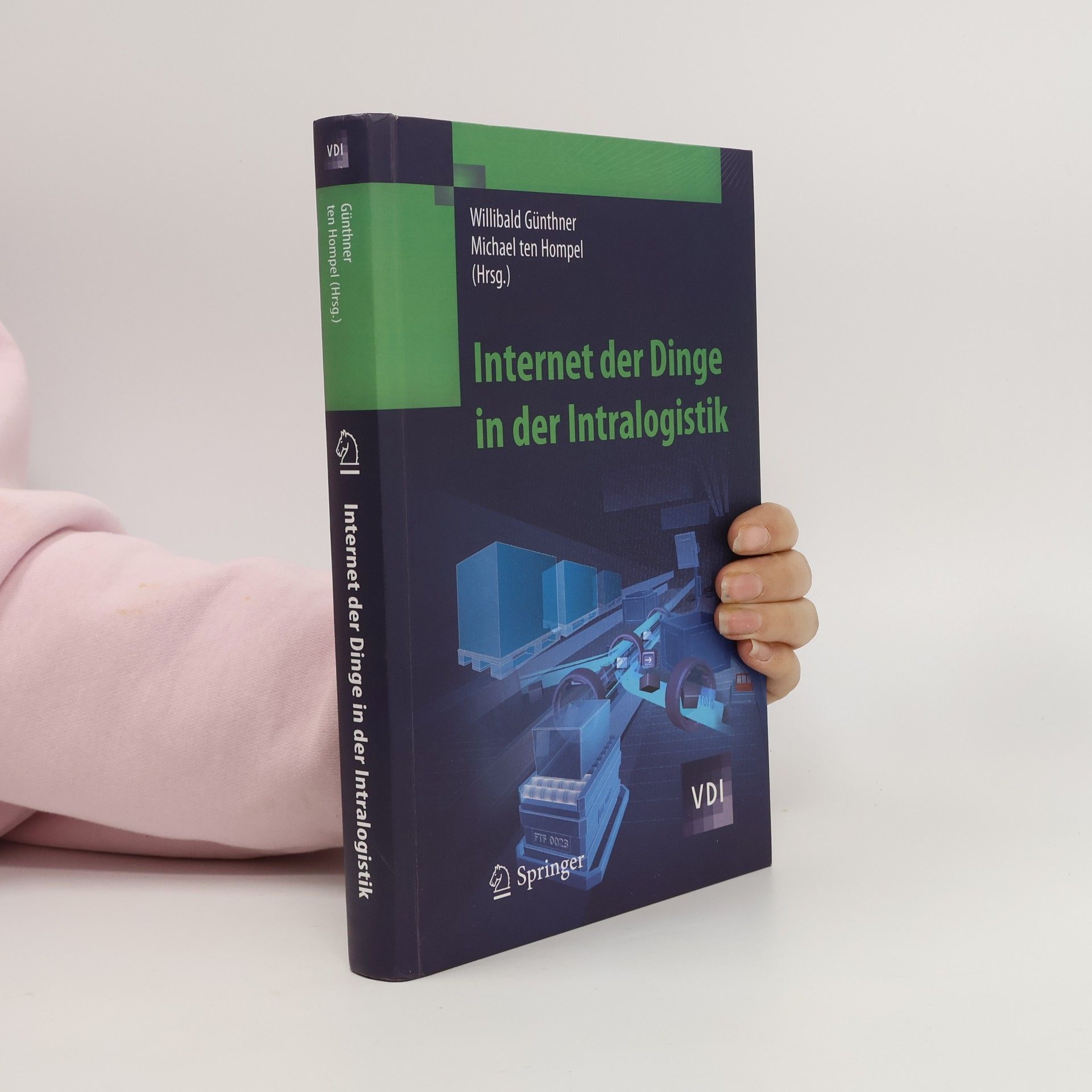VDI-Buch: Internet der Dinge in der Intralogistik
- 358 stránok
- 13 hodin čítania
Die Vision vom sich selbst steuernden Materialfluss, einem Netzwerk von gleichberechtigten Einheiten, die keine übergeordnete Koordination mehr brauchen, beginnt Gestalt anzunehmen. Experten aus Wissenschaft und Technik fordern ein Umdenken in der Intralogistik: weg von durchgeplanten, vorherbestimmten Systemen, hin zu einem „Internet der Dinge". Hier beschreiben sie die notwendigen Komponenten, die Softwarearchitektur und die Potenziale dieser neuen Technologie, geben Beispiele für die industrielle Anwendung und liefern so den Entwicklern und Planern eine Grundlage für die Gestaltung moderner Materialflusssysteme.