Krisen haben (zyklische) Konjunktur – Pandemie, Migration, militärische Konflikte, Rezession und die globale Krise der Demokratie sind markante Symptome der gegenwärtigen Unruhe. Der Band untersucht das Potenzial von Krisendiskursen für literatur- und kulturwissenschaftliche Fragestellungen. Es werden sowohl aktuelle als auch historische Auseinandersetzungen mit sozialen und ökologischen Krisen, individuellen und kollektiven Notständen sowie den sich daraus ergebenden Zukunftschancen und Bewältigungsstrategien thematisiert. Die Analysen reichen bis ins 18. Jahrhundert zurück, wobei der Schwerpunkt auf der Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts liegt, einschließlich Prosa, Theater, Lyrik und Comics.
Primus Heinz Kucher Knihy
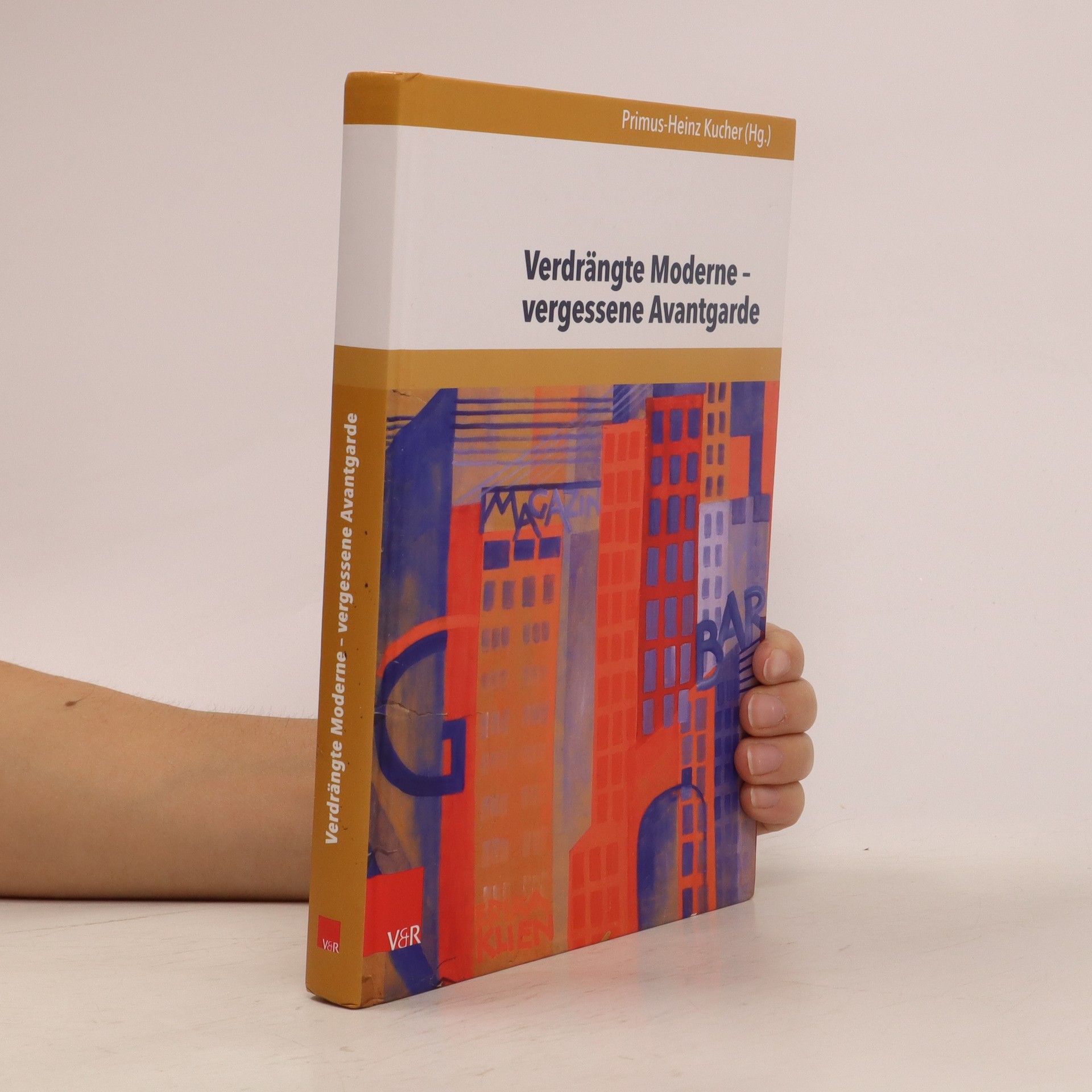

Verdrängte Moderne – vergessene Avantgarde
- 296 stránok
- 11 hodin čítania
Mit der Moderne seit 1880 etablierte sich bereits eine Dynamik, in der eine Koexistenz von Neuem, Artifiziellem, Entgrenzendem mit dem traditionell Schönem anzutreffen ist. Die Avantgardisten dagegen definierten sich stärker durch Akzente des Bruchs, die künstlerische Verfahren radikal ablehnten und neu deuteten. Die Wiener Kultur der Zwischenkriegszeit gilt davon als weitgehend unberührt, obgleich seit 1910 dem Expressionismus zugerechnete Werke entstanden sind. Im Schatten der schwierigen, aber auch von Aufbruch begleiteten 1920er Jahre entwickelte sich in Wien an den Schnittflächen von Theater, Architektur, Literatur, Tanz und Musik ein bemerkenswertes Spektrum konstruktivistisch ausgerichteter Experimente, die weit über Österreich hinaus Resonanz fanden. Diese und andere Konstellationen rekonstruiert dieser Band, der zugleich neue Akzente zum Epochenprofil der Zwischenkriegszeit setzt.