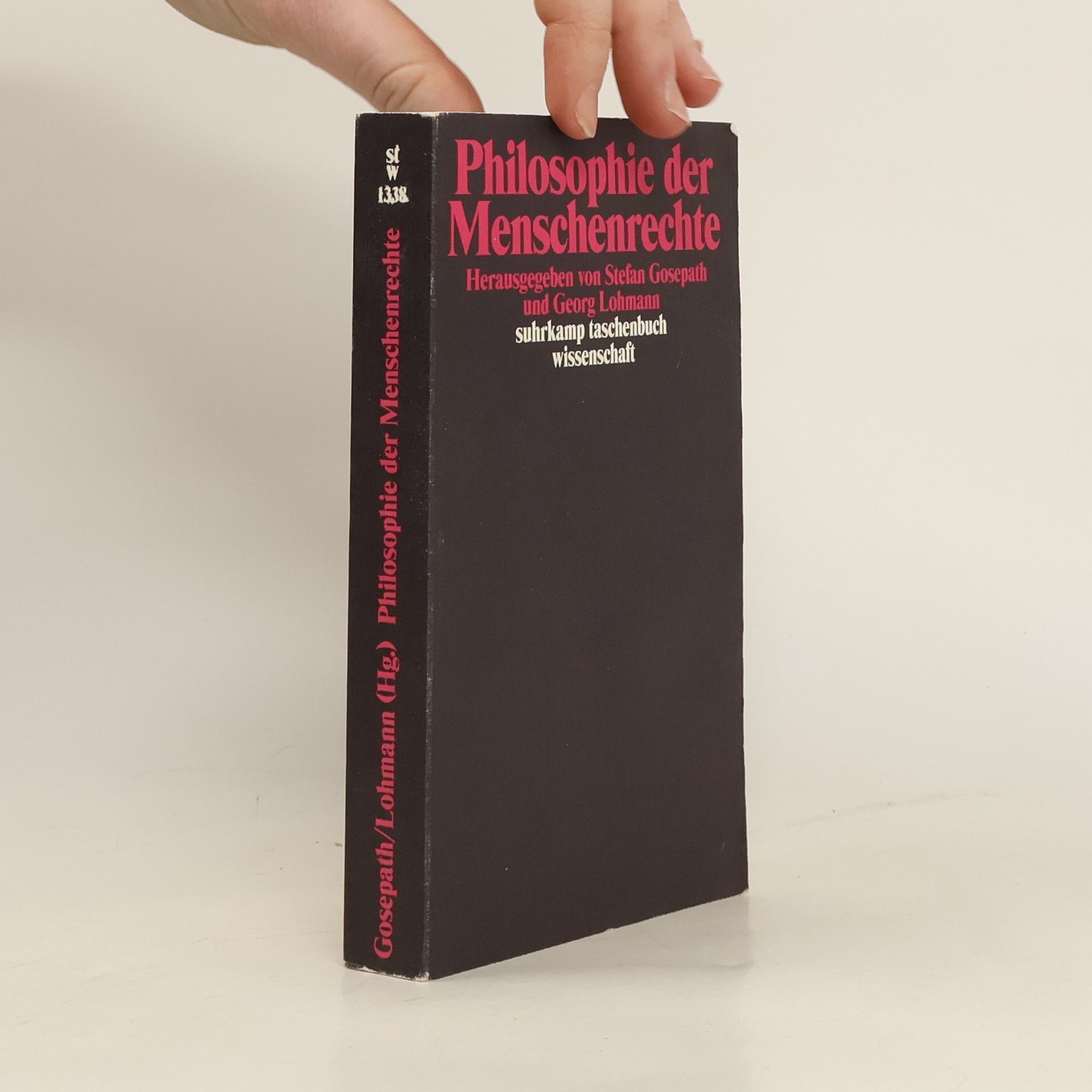Philosophie der Menschenrechte
- 417 stránok
- 15 hodin čítania
Über Menschenrechte wird in jüngster Zeit nicht nur politisch, sondern auch philosophisch gestritten. In diesen Streit will der vorliegende Band mit begrifflichen Klärungen eingreifen. So geht es zunächst um die Frage, ob Menschenrechte moralisch oder juridisch zu verstehen sind, um die Frage ihrer Begründbarkeit und ihres Geltungsbereichs. Je nach der moralischen Deckung der Menschenrechte werden die Ansprüche der sozialen und internationalen Gerechtigkeit und die Spannungen zwischen Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechten unterschiedlich gewichtet.